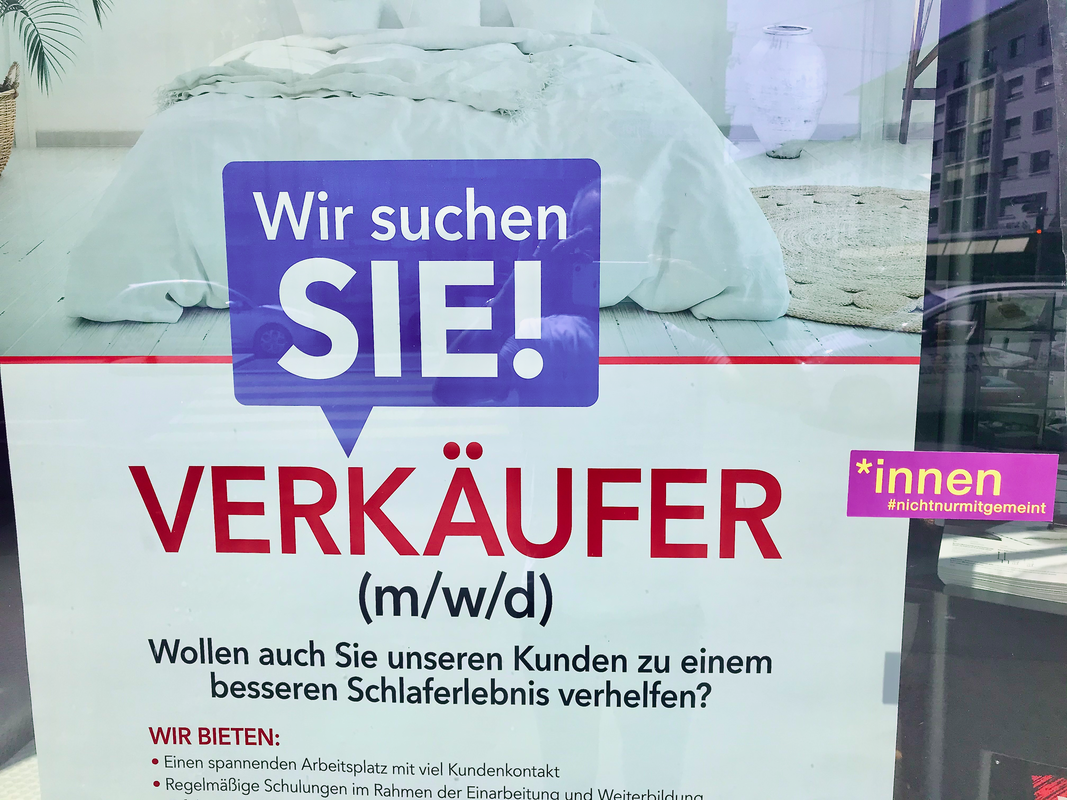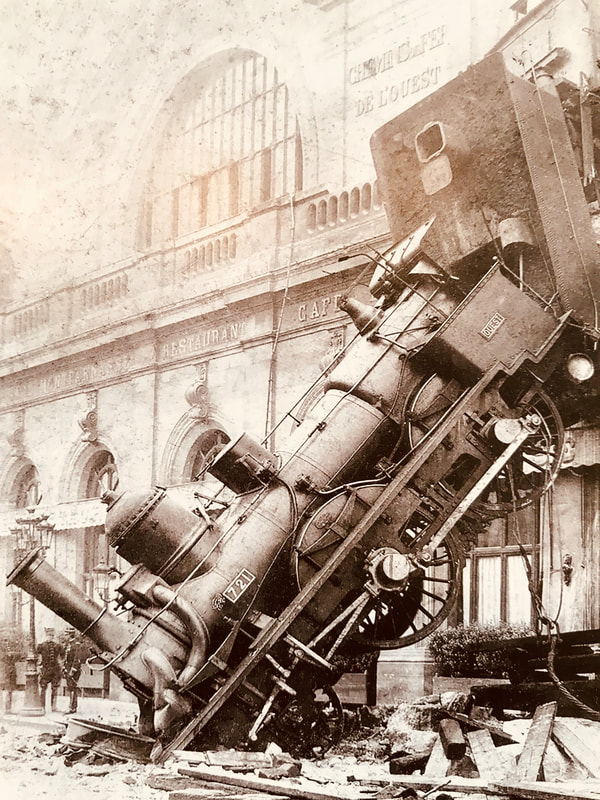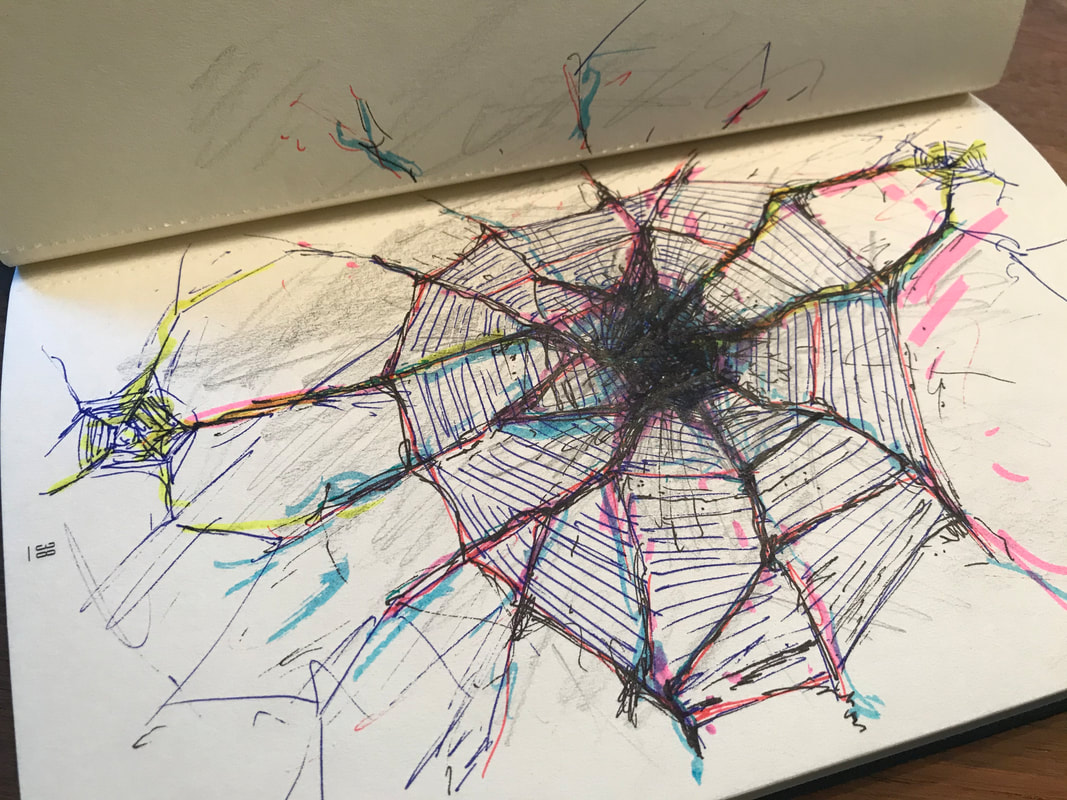HOLZGANT
Ein untrügliches Zeichen für die Ankunft des Frühlings ist die Holzgant.
»Hä, Holzgant?«, fragt ihr euch. Ganz einfach: Gant ist der leicht angestaubte Begriff für eine Versteigerung und gemeint ist damit nicht das bekannte Modelabel. Eine Holzgant ist ergo eine Holzversteigerung. Es gibt immer noch Waldbesitzer, die bieten die Filetstücke des winterlichen Holzschlags zur Versteigerung an. All jene Stämme, die es wert sind, dass man sich darum streitet, werden dem Meistbietenden verkauft. Ich weiß das, weil mein erster Beruf Forstwart war und ich in jugendlichen Jahren meinen Beitrag zu solchen Holzganten geleistet habe.
Jetzt kommt wieder eure berechtigte Furcht, dass reifere Jahrgänge gerne in den Modus »früher war alles besser« verfallen, was allerdings bei diesem Thema nicht der Fall ist. Hier gilt: Heute ist wie früher, nur anders. Denn die Gegenwart hat das Konzept der Versteigerung längst übernommen und in die digitale Welt transferiert. EBay, Ricardo und Konsorte lassen grüßen. Einzig das Ambiente einer Holzgant lässt sich nicht mit dem Prozedere im Internet vergleichen.
Stellt euch vor, da trafen sich früher ausschließlich nur Männer (Frauen gab es in diesem Business schlichtweg keine), ein paar Dutzend Holzhändler, Einkäufer, Förster und geltungssüchtige Gemeinderäte mitten im Wald, die einten versuchten möglichst günstig einzukaufen, die anderen möglichst teuer zu verkaufen. Die Gebote wurden einander zugeschrien, auch wenn man sich in einer Distanz von einem Meter gegenüberstand. Spannend wurde es, wenn es galt, die schönsten Schönheiten zu ergattern. Perfekte Eichen, Eschen, Kirschbäume, Nussbäume, Ahorne, Stämme ohne Äste, gerade gewachsen, die sich für Möbel und Furniere eigneten, ließen die Emotionen hochkochen und die Preise in die Höhe schnellen. Da ging es zur Sache, man überbot sich bis jenseits der Schmerzgrenze, nur um dem Konkurrenten den Triumph des Erfolgs zu vermiesen.
So eine Holzgant dauerte in der Regel den ganzen Tag, was nicht zwingend gewesen wäre, aber der anschließende Apéro fand oft kein Ende und war für mich das Besondere. Nein, nicht wie ihr denkt, wegen des Alkohols, vielmehr war es die Stimmung, die da herrschte. Leute, die sich soeben noch angeschrien, getrieben, überboten und geärgert hatten, stießen zusammen an, lachten und unterhielten sich wie alte Freunde. Was mich zuerst irritierte, musste ich mir erklären lassen. Diese Leute kannten sich seit ewig, man traf sich immer im selben Kreis bei denselben Holzganten, respektierte und schätzte sich und war sich bewusst, dass das System ohne die anderen nicht funktioniert hätte. Eine tolerante Gemeinschaft trotz Konkurrenz, trotz anderen Interessen, trotz unterschiedlicher Denkweise, im Grunde genommen alles kein Problem, für Leute, die die nötige Größe haben.
Findet ihr nicht auch, dass sich dieser letzte, leicht pathetische Satz nicht nur auf Holzganten beziehen sollte?
©Daniel Krumm
April 2022
KATERSTIMMUNG
Die Fasnacht ist vorbei und damit auch die gute Laune. In meiner Stadt dauert das närrisch Treiben genau zweiundsiebzig Stunden, Zeit genug, um den Alltag auszublenden und in eine obskure Parallelwelt einzutauchen. Drei Tage musizieren, meist auf den Beinen, wenig Schlaf, dafür genug Alkohol, nichts Erholsames, mehr körperlicher Raubbau, im Gegenzug dazu wird das Gehirn wieder auf die Grundeinstellung zurückgestellt. Oftmals frage ich mich, was wir hier überhaupt machen und worin der Sinn liegt, aber dies ist der völlig falsche Ansatz, außer man will die Magie der Fasnacht zerstören.
Auf jeden Fall liegt der ganze Zauber in der Vergangenheit. Wie von einem Wecker aus dem Schlaf gerissen, wachen wir mitten im Alltag auf, als wäre alles nur ein Traum gewesen. Das Licht blendet die entzündeten Augen, der Kopf schmerzt, ein flaues Gefühl im Magen, Katerstimmung, aber nicht wegen den Auswüchsen der Fasnacht, nein, es ist die Realität, die mit voller Wucht zuschlägt. Verflucht, es hat sich während diesen drei Tagen nichts geändert, diesen Scheißkrieg gibt es immer noch. Man sollte nicht fluchen, aber hier scheint es mir irgendwie angebracht.
Tatsache ist, man kann die Realität nicht wegfeiern, selbst mit Musik, Alkohol und guter Laune nicht. Was übrig bleibt nach drei Tagen, ist eine Kombination aus schönen Erinnerungen und einem schalen Nachgeschmack. Trotz der politischen Bissigkeit der Fasnacht und dem Spiegel, welcher der Narr der Gesellschaft vorhält, ändert sich die Welt nicht, dafür hat das fasnächtliche Treiben zu wenig Relevanz zu bieten. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die Fasnacht etwas an den Grundeinstellungen in unseren Köpfen bewirkt. Im Umkehrschluss müsste man zugeben, dass auch der Verzicht auf die Fasnacht die Welt nicht besser werden liesse. Dies wäre eine beruhigende und zugleich enttäuschende Behauptung. Das Ganze schrumpfte zu einem profanen Vergnügen mit pseudokritischem Unterton.
Ich weiß, ich bin eben dabei, das eigene Nest zu beschmutzen und mich in Widersprüche zu verwickeln, denn ich habe während der Fasnacht viel gelacht und starke Momente erlebt, möchte sie nicht missen. Ich denke, hier kommt die Ambivalenz der Fasnacht zum Tragen: Eine dreitägige Euphorie mitten in der harten Realität, ein Sonnenstrahl, der sich durch die dunklen Gewitterwolken zwängt, ein Blümchen, das durch den Asphalt wächst. Ja, so in etwa könnte man die Fasnacht umschreiben und so sollte sie weiterhin Bestand haben.
Wichtig ist, dass ihre Bissigkeit nicht zu einem gewöhnlichen Rausch verkommt. Statt der Katerstimmung gäbe es eine düstere Ernüchterung.
©Daniel Krumm
März 2022
AMBIVALENZ
Im Zuge des medialen Bombardements mit olympischen Bildern von weißen Streifen in dreckbraunen Landschaften und rotweißen Sportlern, die in güldene Dosendeckel beißen, wird man unweigerlich mit einem Land namens CHINA konfrontiert. Und damit beginnt bei mir eine ausgeprägte Ambivalenz. Ich stolperte über dieses Fremdwort, welches so viel wie Zerrissenheit, Zwiespältigkeit bedeutet und bei mir sofort einen gedanklichen Kurzschluss verursachte. Lustig, wie es manchmal nur eines Stichwortes bedarf, um ganze Gedankenlawinen auszulösen. Egal, auf jeden Fall löst das Stichwort CHINA bei mir einiges aus.
Vielen von uns ist dieser Staat im wahrsten Sinne des Wortes ein rotes Tuch, verziert mit fünf gelben Sternen. Eine Supermacht am anderen Ende der Welt mit einer Kultur, die uns vielleicht kulinarisch begeistern vermag, aber mit einer uns völlig fremden Ideologie ausgestattet, in erster Linie verunsichert und einschüchtert. Ein Land mit unersättlichem Machtanspruch, den es sich als Werkplatz der Welt fleißig erarbeitet hat. In diesem letzten Satz liegt die Ambivalenz.
Dieses Land schenkt uns ungezügelten Konsum. Dank anspruchslosen Arbeitskräften und einem großzügigen Umgang mit der Umwelt und Menschenrechten bereichern sie unser Leben mit billigen Produkten, die wir größtenteils gar nicht bräuchten. Jetzt kann man sich fragen, ob CHINA uns auf hinterlistige Weise zum Konsum verführt oder ob CHINA uns nur mit dem beschenkt, was wir uns sehnlichst wünschen. Eine Frage, die wir uns stellen sollten, denn die Antwort darauf gibt uns einen Hinweis, was schlussendlich dieses Land so mächtig macht.
Einverstanden, CHINAS schiere Größe mit seinen 1,4 Milliarden Einwohnern ist bereits pure Macht, aber immer noch nicht Grund genug, uns diesem Land an den Hals zu werfen. Vor allem erscheint Olympia in CHINA irgendwie wie ein Hohn, wenn man bedenkt, dass das Ganze dem Leitgedanken «Sport, Fairness, Freundschaft und Respekt» verpflichtet wäre. Als würde man im Schlachthof ein veganes Restaurant eröffnen. Pathetisch ausgedrückt, kommt es mir vor, als hätte man diese ideellen Werte und die Sportler auf dem Altar der Macht geopfert. Aber solange wir jubelnd Medaillen abräumen, verlieren wir den Blick auf die dunklen Seiten dieser Macht und damit meine ich nicht Darth Vader. Gleich, wie wir schweigen, solange unser Konsum möglichst nichts kostet.
Bin ich der Einzige, dem unsere Scheinheiligkeit auf den Sack geht? Oder ist das nur eine ganz normale Ambivalenz?
©Daniel Krumm
Februar 2022
TESTBILD
Beim Anblick dieses Fotos befürchtet ihr, dass da wieder mal einer mit den guten alten Zeiten kommt, die alleweil besser waren, als das, was uns heutzutage geboten wird. Aber was soll denn an einem Testbild besser gewesen sein?
In der analogen Vergangenheit konnte mit Hilfe des Testbildes der Empfänger eingestellt werden, weshalb dieses kryptische Bild außerhalb der Sendezeit aufgeschaltet wurde. Es gab also eine Sendepause, die in der Regel nach Mitternacht begann und anderntags nach der Mittagszeit endete. Daran kann ich mich gut erinnern, später wurde die Sendepause immer kürzer, bis sie in den Neunzigerjahren durch das Satelliten- und Privatfernsehen komplett aufgehoben wurde. Damit verschwand auch das Testbild.
Irgendwie bedaure ich das, denn es war ein klares Zeichen, dass es nichts zu sehen gab, sollte man unsinnigerweise den Fernseher außerhalb der Sendezeit eingeschaltet haben. Vielleicht dudelte seichte Musik im Hintergrund oder ein nervtötender 1000-Hertz-Signalton war zu hören, ansonsten gab es da nur ein starres Bild über Stunden hinweg. Das Testbild war das Zeichen für das absolute Nichts und es gab keine Alternative, da das halbe Dutzend Sender, die über die Antenne zu empfangen waren, die Sendepause parallel ungefähr geschaltet hatten.
Jetzt, meine lieben Freunde, komme ich zum Kern meiner fragwürdigen Einsicht und es ist gut möglich, dass ihr meinen Gedankengang erahnt: ICH SEHNE MIR DAS TESTBILD WIEDER HERBEI! Denn was ich nicht verstehe, ist: WARUM HAT MAN DIE GUTE ALTE SENDEPAUSE NUR MIT MÜLL GEFÜLLT? Einverstanden, seit der Erfindung des Fernsehens werden wir Zuschauer immer wieder von den Sendern mit Dreck beworfen und nehmen das bis heute einfach so hin, schlimmer noch, wir bezahlen dafür. Da kommt ihr und entgegnet, das sei doch halb so dramatisch, es gäbe ja am Gerät einen Knopf, worauf ich euch grundsätzlich recht gebe, aber behaupte, dass mangels Alternative da niemand drauf drückt.
Ist denn der Fernsehkonsument ein Masochist oder betrachtet er Fernsehglotzen als Busse für all seine begangenen Sünden? Jetzt werdet ihr denken, dass ich einer jener bin, der sich in intellektueller Selbstüberschätzung über den kommunen Fernsehzuschauer stellt und die Welt vor schlechter Unterhaltung und Trash bewahren will. Seid beruhigt, ich bin kein Missionar und es ist mir völlig wurscht, was ihr schaut, denn ich denke in erster Linie an mich selbst. Ich gaffe ja auch ab und zu in diese Kiste, darum wünsche mir nichts anderes als ein Programm, welches mich nicht in den Wahnsinn treibt, sondern ein wenig Freude, Interesse und Spannung weckt. Ist das zu viel verlangt? Eigentlich nicht. Oder doch?
Aber ganz unter uns, ich hätte die perfekte Alternative zu einem miesen Fernsehprogramm: Drückt auf den Knopf und lest ein Buch! Am besten eins von mir ...
©Daniel Krumm
Februar 2022
BAUSTELLE
An dieser Straße in meiner Stadt wird gearbeitet, es ist eine Langzeitbaustelle, die sich mehrere Jahre hinzieht. So, wie es hier ausschaut, kann das Bauwerk wohl nicht als beendet betrachtet werden. Es ist eine jener Baustellen, mit der alles erneuert wird, was erneuert werden kann, alle Versorgungsleitungen, die Haltestellen der Straßenbahn, die Kanalisation, der Fahrbahnbelag, die Randsteine, die Bäume und gleichzeitig werden Parkplätze für Autos aufgehoben. Ich bin mir nicht sicher, ob im Zuge dessen auch die Anwohner ausgewechselt werden.
Aktuell wird das Fernwärmenetz ausgebaut, was der Stadt bis 2035 mit Gräben durchfurchte Straßen, Umleitungen, Lärm, Behinderungen und Ärger garantieren wird, aber nicht genug, wenn ich lese, was man alles plant, dann verkommt diese Stadt zu einer einzigen Baustelle. Wäre es nicht einfacher, die ganze Stadt abzureißen und neu zu bauen? Befindet sich diese Stadt in einer Transformationsphase oder war das schon immer so? Ich denke, wir können es uns leisten, vor allem, wenn man sieht, wie nur die besten Zutaten verbaut und die berühmtesten Architekten beauftragt werden. Eine reiche Stadt klotzt.
Zurück zu dem Foto. Es zeigt uns ein schwer erklärbares Phänomen. Wenn ihr den Schienenverlauf der Straßenbahn betrachtet, dann wird euch sicherlich ein wenig schwindlig. Ich habe drei Erklärungen dafür:
- Durch eine unerwartete Verschiebung der Kontinentalplatten wurde der Verlauf der Schienen beeinträchtigt.
- Damit die Straßenbahn nicht zu schnell fährt, hat man Schikanen eingebaut.
- Der Planer ist dem Alkohol verfallen.
Am besten verkaufe ich mein Auto und leiste mir einen Bagger!
©Daniel Krumm
Januar 2022
DARWIN AWARD
Kennt ihr den Darwin Award? Nicht? Bis vor kurzem kannte ich ihn auch nicht, aber jetzt, wo man mir seinen Sinn und Zweck erklärt hat, betrachte ich viele Dinge aus einer anderen Perspektive. Wie ihr wisst, sind Awards Preise für außerordentliche Leistungen, meist in kulturellen Bereichen. Da gibt es den MTV Video Music Award, den Golden Globe Award, die Grammy Awards, den Red Dot Design Award und so weiter und so fort. Aber was hat es sich mit dem Darwin Award auf sich?
Er wurde 1994 von Biologiestudenten der Stanford University ins Leben gerufen und soll Menschen auszeichnen, die sich durch eigenes Verschulden und auf besonders dämliche Art und Weise aus dem Leben verabschiedet haben. Charles Darwin, der die Evolutionstheorie entwickelte, gilt als Entdecker der natürlichen Auslese, also der These, dass Spezies sich entwickeln, indem deren mangelhaften Lebewesen sich selbst eliminieren und so verhindern, dass sie ihre minderwertigen Gene weitervererben.
Als Beispiel der Gewinner von 2019: Der 47-jährige Tetsu Shiohara bestieg den höchsten Berg Japans im Winter, also außerhalb der Saison, unzureichend ausgerüstet und falsch bekleidet. In einem Livestream übertrug er seinen Aufstieg im Schnee und bevor er ausrutschte und in den Tod stürzte, erklärte er den Zuschauern noch, wie verdammt gefährlich diese Besteigung doch sei. Selten dämlich! Das Filmchen samt seinem Sturz kann man sich auf Youtube ansehen. Übrigens sei erwähnt, dass es beinahe nur maskuline Preisträger gibt, es ist also nur eine Frage der Zeit, bis die Männer sich selbst aus der Schöpfung entfernt haben.
Jetzt kann man geteilter Meinung sein, ob man solche Dramen der Lächerlichkeit preisgeben darf, aber Hand aufs Herz, wer muss bei derartigen Dummheiten nicht schmunzeln. Man nennt das schwarzer Humor, eine Spezialität der Briten. Monty Phyton, Marty Feldman, Dave Allen und Company lassen grüßen (Entschuldigt, ich schweife ab). Die Einen entgegnen, es gäbe einen Unterschied zwischen der Realität und fiktiver Komik, die Anderen meinen, das spiele keine Rolle, denn Komik sei der Spiegel der Realität.
Ja, die Realität, mit der ist es so eine Sache. Ich sehe nämlich täglich Kandidaten (vornehmlich maskulin) für den Darwin Award, die einzig nicht für den Preis in Frage kommen, da sie noch leben. Jene Fahrradfahrer nämlich, die sich guerillamäßig und todessehnsüchtig in den Kreisverkehr stürzen, die bei Rot mit dem Handy in der Hand über die Kreuzung brettern, die Verkehrsregeln als unverbindliche Empfehlung betrachten, die sich als die Krönung des Straßenverkehrs sehen und nur überleben, weil der Rest des Verkehrs auf sie Rücksicht nimmt.
Irgendwann wird ein Fahrradfahrer sich filmen, wie er sich frisch fröhlich selbst eliminiert. Vielleicht reicht dies für: AND THE WINNER IS ...
©Daniel Krumm
Januar 2022
SINNFRAGE
Ergeht es euch manchmal nicht auch so wie dieser Frau auf dem Gemälde? Der Blick schweift über den Schreibtisch, bleibt haften an den Unterlagen, die sich da stapeln, schwenkt zum Bildschirm und du glotzt in die hypnotisierende Helligkeit der unzähligen Leuchtdioden, ohne wahrzunehmen, was da gezeigt wird. Wieder einmal ist die Verbindung zwischen Sehnerv und Stammhirn außer Betrieb und ein zäher Nebel aus Schwermut legt sich über das Dasein. Wieder einmal ist es Zeit für die große Sinnfrage. Nein, nicht die Frage nach dem Sein, das wäre was für Fortgeschrittene, es reicht schon die simple Frage nach dem Tun. Was tue ich da? Macht es überhaupt Sinn, was ich tue? Und ist es die Zeit wert, die ich in dieses Tun investiere? Ist es das Gehalt wert, das ich dafür bekomme?
Grundsätzlich ist es nicht falsch, sich in periodischen Abständen kritisch zu hinterfragen, denn nur so verliert man nicht das große Ziel aus den Augen. Aber wer macht das schon bewusst und wer will wirklich wissen, ob man seinem Tun eine sinnvolle Erfüllung gewährt. Dabei liefe man auch Gefahr, zu erkennen, wie viel im eigenen Tun nur Leerlauf und inhaltslose Beschäftigung ist. Eine Tatsache, die durchaus sinnvoll ist, da wir sonst an einem Übermaß an Sinn verbrennen würden. Wie eine Sicherung, die es raushaut, sobald zu viele Elektrogeräte an einer Steckdose hängen. Zack, und es wäre dunkel.
Ja, große Denker und Philosophen sind und waren immer gefährdet, verrückt zu werden. Ich bin es nicht, denn ich erwische mich oft, wie ich keinen Sinn hinter meinem Tun finde, da kann ich suchen, so lange ich will. Da erstelle ich eine Liste, die mit Sicherheit im Papierkorb landet, da kläre ich etwas ab, das schlussendlich kein Schwein interessiert, da setze ich mich voller Enthusiasmus für eine Sache ein, deren Wichtigkeit im Dschungel der Administration verpufft, da schreibe ich und kaum jemand liest es. Oder ich glotze abends in den Fernseher und am folgenden Tag habe ich keine Ahnung mehr, was ich mir angeschaut habe. Sinnentleertes Handeln in Reinkultur und das nicht nur ein Mal die Woche. Weitere Beispiele gefällig? Nein? Ist auch nicht nötig, denn, wie gesagt, wir wissen alle, wie wichtig sinnfreies Tun für den Seelenfrieden ist. Wenn ihr bei der Arbeit noch Geld dafür bekommt, dann solltet ihr dafür dankbar sein. Nicht allen sei dies gegönnt.
©Daniel Krumm
Dezember 2021
DEKORATION
Da stand ich im Musée d’Orsay in Paris vor diesem Bild und war irritiert. Ich musste mich zuerst auf dem kleinen Schild daneben kundig machen.
Dieses impressionistische Gemälde wurde 1863 von Édouard Manet gemalt und heißt Le Bain (Das Bad), wird auch Le Déjeuner sur l’herbe (Das Frühstück im Grünen) genannt. Manet war einunddreißig Jahre alt, als er dieses Werk erschaffen hat und am Pariser Salon ausstellen wollte, aber von den Juroren verschmäht wurde. Kaiser Napoleon III hatte Mitleid mit den abgewiesenen Künstlern und gab ihnen die Gelegenheit, ihre Werke im Salon des Refusés (Salon der Abgelehnten) auszustellen. Dort wurden die disqualifizierten Kunstwerke, mehrere tausend an der Zahl, wandfüllend, ohne Zwischenräume, nebeneinander und übereinander aufgehängt. Ein Flohmarkt für miese Kunst.
Aber jetzt zum eigentlichen Grund meiner Irritation und gleichzeitig zur Ursache der damaligen Ablehnung: Eine nackte und eine leicht bekleidete Frau, während die beiden Männer vollständig, ja beinahe formell, angezogen sind. Für mich ein klarer Hinweis auf die einstmalige patriarchalische Gesellschaft, in der Frauen hauptsächlich zur Dekoration, zur Verlustierung, zur Arbeit oder zur Arterhaltung dienten. Ein Bild der damaligen Sozialstruktur und der damit verbundenen Herabwürdigung der Frau. Der Verdacht kommt auf, dass sogar die hochgelobte Kunst das weibliche Wesen nur als ästhetisches Objekt schätzte.
Vorsichtig schaute ich mich um und erwartete jeden Moment eine Genderaktivist*in mit einer Spraydose in der Hand, um diese Entgleisung mit roter Farbe zu korrigieren. Ich muss zugeben, dass ich etwas überrascht war ob der Konstellation der Protagonisten bei diesem Picknick. Reichlich sexistisch. Findet ihr nicht auch? Vermutlich waren das frivole Zeiten in Paris.
Alles Mumpitz! Ja, es hat mir keine Ruhe gelassen und ich eignete mir auf der Stelle im Internet das nötige Halbwissen an. Nur so kann ich euch erklären, wieso das Bild abgelehnt wurde und sogar einen ausgewachsenen Skandal auslöste. Die nackten Frauen waren der Anstoß! Also doch. Aber nicht wie ihr meint, nein, denn es ging um die Regel, dass Frauen nur als religiöse oder mythologische Figuren in ihrer Nacktheit gezeigt werden durften. Manet befreite sie mit diesem Bild von ihrer dekorativen Aufgabe, indem er die Nackte selbstbewusst und beinahe herausfordernd zum Betrachter schauen lässt. Eine bewusste Unverschämtheit, die kaum jemand verstand. Ja, er war ein Wegbereiter der modernen Malerei, auch weil er den Mut besaß, entgegen seiner Zeit Zeichen zu setzen. Ein Stück Kunst- und Gesellschaftsgeschichte.
Ich ziehe den Hut vor ihm und gleichzeitig frage ich mich, was wäre, wenn er dieses Bild heute malen und ausstellen würde. Ja, es wäre von neuem eine Provokation, aber eine völlig andere und das Bild hinge vermutlich schon wieder im Salon des Refusés.
©Daniel Krumm
Dezember 2021
DÖRRBOHNEN
Kennt ihr Dörrbohnen? Eine Schweizer Spezialität aus gewöhnlichen, luftgetrockneten Gartenbohnen, die aussehen wie Algen, welche zu lange an der Sonne lagen. Ich liebe sie, denn sie gehören zu jenen Lebensmitteln, die mich seit der Kindheit begleiten. Sie haben in meiner Ernährung den Status des Matterhorns, war schon immer da und wird es auch bleiben. Zu herzhaften Mahlzeiten mit Speck, Rippchen, Wurst und Salzkartoffeln passen perfekt die Dörrbohnen und sollte jetzt jemand ob der Ungesundheit dieser Speisen die Nase rümpfen, dann muss ich widersprechen, denn zumindest die Dörrbohnen sind reich an pflanzlichem Eiweiß, Vitamin C, Vitamin K, Folsäure, Kalium, Kalzium und Magnesium. Kein Junkfood! Zudem schmecken sie viel intensiver als die frischen Bohnen und haben einen fleischigen Biss. Eine Delikatesse, die einer uralten Konservierungsmethode zu verdanken ist. Ich kann mich bestens an die Dörrapparate erinnern, die auf jedem Bauernhof pausenlos im Einsatz standen.
Das war einmal, denn da brach doch für mich eine ganze Welt zusammen, als ich letzte Woche erfuhr, dass die Dörrbohnen vornehmlich aus China stammen. Es war also eine Illusion, zu meinen, dass es unsere Bäuerinnen waren, die mit ihren Dörrapparaten die frischen Hülsenfrüchte verschrumpelten. Die Realität ist schlichtweg ernüchternd. Da wird ein unspektakuläres Gemüse, welches hier heimisch ist und wunderbar bei uns wächst, 10’000 Kilometer über die Meere geschippert, nur weil das Kultivieren und Dörren der Bohnen da billiger ist. Vermutlich Kinderarbeit! Eine Tatsache, die übrigens schon seit Längerem gilt. Aber nicht genug der Frustration! 100 Gramm der chinesische Dörrbohnen kosten beim hiesigen Großhändler ein Franken siebzig (1.70 Fr.) und die einheimischen mit Bio-Zertifikat sechs Franken fünfzig (6.50 Fr.). Lasse man sich das auf der Zunge zergehen. Da bleibt mir doch gleich die Dörrbohne im Halse stecken, zumindest die chinesische.
Und was will ich euch damit sagen? Äh, eigentlich nichts, denn ich bin einfach nur sprachlos. Oder was meint ihr, soll ich mir einen Dörrapparat kaufen?
©Daniel Krumm
November 2021
HUHN
Ich denke, es ist höchste Zeit, dass für das Huhn eine Lanze gebrochen wird. Bei Recherchen habe ich mich mit dem Huhn beschäftigt und kam zur Erkenntnis: Das Huhn verkauft sich völlig unter seinem Wert, hat das falsche Image und verfügt über keine Lobby. Um die Lebensbedingungen für das Huhn zu verbessern, müsste es den Stellenwert des Hundes oder der Katze erhalten, dann würde es verhätschelt, nur mit dem Besten gefüttert, tierärztlich überversorgt und einfühlsam bis in den humanen Tod begleitet. Logisch, wer quält und isst schon sein Haustier! Was auf dem Teller landet, möchte man nicht zu viele Gefühle entgegenbringen.
Das ist schade, denn das Huhn ist ein sanftmütiges, soziales und intelligentes Wesen, welches die Zuneigung des Menschen schätzt und erwidert. Glaubt mir, sich in einen Hühnerhof zu setzen und zu beobachten, ist besser als ein Zoobesuch. Plötzlich merkt man, dass das Gegacker, gar keines ist, sondern eine nuancierte Sprache. Hat sich dieses Federvieh erst an jemanden gewöhnt, vergisst es ihre Scheu und kommt sehr nah, beginnt sanft zu plaudern, erzählt irgendetwas in melodiösen Lauten und sucht immer wieder den Augenkontakt. Ja, bei einem Wiedersehen kommt es sogar angerannt, legt den Kopf schief und grüßt. Es dauert nicht lange, bis es Zutrauen gewonnen hat und aus der Hand frisst, liebesbedürftige Exemplare kuscheln sich auch gerne an einen Menschen. Der Hahn allerdings zeigt sich eher von seiner distanzierten Seite, aber solange ich sein Huhn nicht belästige, akzeptiert er mich.
Aber eben, das Huhn ist leider auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Unlängst wurde im Parlament beraten, ob das Einfuhrkontingent für Eier erhöht werden muss, da das Volk seit der Pandemie mehr davon verbraucht. Verrückt, das Ei als Politikum! Vermutlich hat das mit Lockdown-Backen zu tun oder so was Ähnliches und das einheimische Huhn schafft es nicht, die gesteigerte Nachfrage zu befriedigen. Aber das ist längst nicht alles, was das Huhn zu bieten hat. Es liefert auch zartes und fettfreies Fleisch, welches in der gesunden Ernährung seinen festen Platz erobert hat. Es ist eine veritable Lebensmittelmaschine und beschert uns Delikatessen, die wir nicht missen möchten. Unteranderem auch massentauglicher Junkfood! Billiges, anibiotikabelastetes Fleisch aus zweifelhaften Mästereien (übrigens auch aus der Schweiz), wo man fünfzehn Hühner auf einem Quadratmeter hält und wo binnen dreißig Tagen 60 Gramm leichte Küken zu zwei Kilo schweren Brathähnchen aufgeblasen werden. Näher auf den Missbrauch des Huhns einzugehen, macht wenig Sinn. Man will es einfach nicht hören.
Ich weiß, man sollte keine Sympathien zu einem lebenden Lebensmittel hegen, sonst gerät man unweigerlich in einen Konflikt, aber es fällt mir zurzeit tatsächlich leichter, einen Gemüseauflauf zu essen, als in ein knuspriges Hähnchenschenkel zu beißen.
©Daniel Krumm
Oktober 2021
FLOHMARKT
Hier im südfranzösischen Languedoc haben die Flohmärkte eine starke Tradition. Ich weiß nicht, ob sich hier über die Jahre mehr Gerümpel angesammelt hat oder ob die Menschen hier die verstaubten Requisiten ihres Lebens lieber verkaufen, als wegwerfen. Der Brocante in Sommières, der sich jeden Samstag unter den Platanen vor der Arena ausbreitet, versprüht einen ausgesprochen muffigen Charme des Vergangenen. Als hätte man alte Häuser ausgeschüttet. Da findet man lauter Dinge, die rührselige und längst vergessene Geschichten erzählen, aber auch solche, die besser unter Verschluss geblieben wären.
Dieser knopfäugige Teddybär auf dem Foto ist so ein Fundstück, welches bei mir zwiespältige Gefühle auslöst. Einerseits sieht er aus, als wurde er von der Vergangenheit ausgekotzt, andererseits diente er unendliche Stunden lang als engster Begleiter durch ein Kinderleben. Er wurde nicht benutzt, er wurde abgenutzt. Wie viele Tränen versickerten in ihm, wie oft war er Trost und Freund, was bekam er nicht alles zu hören? Möglicherweise verhalf er einem Kind zu einer lebenswerten Kindheit. Wenn er nur reden könnte.
Nun sitzt er hier in dieser rostigen Karre und schaut verloren in die Welt, die ihn nicht mehr haben will. Wer möchte mit diesem schmuddeligen Monster schon kuscheln, in den sich vermutlich einiges an Ungeziefer eingenistet hat. Und trotzdem fasziniert mich dieser Teddy. Er erinnert an einen Kriegsveteranen. Er hat gedient, wurde verschlissen und bekam dabei seine äußeren und inneren Verletzungen ab, wartet nun auf sein endgültiges Ende. Man sollte ihm für seine selbstlosen Taten eine Verdienstmedaille an sein seltsames Kleidchen heften. Andererseits ist er hässlich und man fragt sich, was ein Kind in diesem Wesen noch Liebevolles gesehen hat. Wir können es nur erahnen. Aber er ist auch etwas unheimlich und gruselig. Es gibt Horrorgeschichten, in denen werden solche Figuren nachts lebendig.
Ich habe ihn nicht gekauft, dafür hängt jetzt bei mir zu Hause ein verbeulter und angerosteter Kühlergrill eines Peugeots 301 Jahrgang 1933 an der Wand. Seine Geschichte scheint mir weniger emotional belastet als jene des Teddys. Man will ja in Ruhe schlafen können.
Ein Tipp: Menschen mit zu viel Fantasie sollten Brocants meiden.
©Daniel Krumm
Oktober 2021
OLYMPIA
Es soll ja Leute geben, die haben die olympischen Ringe unter den Augen, weil sie jeden Wettkampf während den vergangenen offiziellen 17 Tagen mitverfolgt haben. Schließlich gibt es an diesen Spielen auch ein verrücktes Angebot an nervenzerfetzenden Kämpfen in seltsamen Sportarten und viele wissen nicht, ob sie jetzt beim Luftgewehrschießen, Synchronschwimmen, Dressurreiten oder beim Skateboard mitfiebern wollen. Hand aufs Herz, wer von uns zeigt Interesse an Randsportarten, außer sie finden an der Olympiade statt oder man übt sie selbst aus. Aber das spielt ja keine Rolle, denn Hauptsache man schaut sich die Augen wund und berauscht sich am kollektiven Erfolg der eigenen Nation.
Heuer fand das Happening in Tokyo statt, drei Wochen Sport ohne Zuschauer und das Ganze hat satte 12 Milliarden gekostet. Respekt, dass man für 33 Sportarten so viel Geld ausgeben kann. Das ergibt ungefähr 360 Millionen pro Sportart oder über 700 Millionen pro Olympiatag. Wahnsinn, nicht? Und abgesehen davon, werden die Japaner noch lange Freude an den Folgekosten und den überflüssigen Sportstätten haben.
Der nächste fragwürdige Event, die Fussball-Weltmeisterschaften in Katar, dem Mutterland des Fussballs, ist im Anmarsch. Ein wenig Aufregung im Vorfeld über eine seltsame Vergabe, über ein paar hundert Tote auf den Baustellen der Stadien, über acht Stadien, die anschließend nie mehr gebraucht werden und über ein zu heisses Klima für Fußball zählen nicht als Argumente gegen dieses Ereignis. Übrigens hat Katar 2,7 Millionen Einwohner und die acht Spielstätten, die übrigens schlappe 4 Milliarden kosten, werden 386‘000 Zuschauer fassen, was bedeutet, dass 14,3% der einheimischen Bevölkerung in Zukunft live Fußball gucken kann. In der Schweiz mit 8,6 Millionen Einwohnern gehen pro Woche selten mehr als 90‘000 Zuschauer in die Stadien. Das alles wird keine Rolle mehr spielen, nachdem die Weltmeisterschaften erstmal angepfiffen wurden. Und wie immer zum Schluss werden sich die Walliser Funktionäre wieder auf die Schultern klopfen und sich mit den Siegern feiern lassen.
Wenn wir Schweizer Weltmeister werden, dann geht das ja in Ordnung, sonst sehe ich mich gezwungen, diese Veranstaltung vehement in Frage zu stellen.
©Daniel Krumm
August 2021
BERGWANDERN
In dieser postcoronalen Zeit ist Urlaub im Ausland etwa so einladend wie ein Besuch beim Zahnarzt und ein Urlaub ohne Einschränkungen vergleichbar mit den Gewinnchancen bei Euromillion. Ich hatte ja noch nie was gewonnen, also gingen wir auf sicher und mieteten hier in der Schweiz eine einsame Alphütte, um uns während zwei Wochen dem Bergwandern zu widmen.
Um gleich die Situation zu klären: Es ist nicht meine Passion, auf Berge zu kraxeln! Aber was unternimmt man nicht alles für eine harmonische Beziehung. Trotzdem waren Diskussionen nicht zu vermeiden, denn spätestens beim Erklimmen der ersten Anhöhe stellte sich die große Sinnfrage, die ich beantwortet haben wollte: Warum läuft man zuerst den Berg hoch, um dann wieder hinunterzusteigen? Oder: Wieso bezwingt man mühsam einen Gipfel, wenn daneben eine Bahn hochfährt?
Mit solchen Fragen wird man von Wander-Enthusiasten nur entgeistert angeglotzt, zum Ignoranten abgestempelt und bestenfalls lässt sich jemand herab, um mir den wahren Sinn des Wanderns zu erklären: Freude an der Natur, die gute Luft, die körperliche Ertüchtigung, die Erhabenheit der Aussicht, der Stolz auf die vollbrachte Leistung und so weiter und so fort.
Okay, aber wie oft im Leben entspricht das Ideal nicht immer der Realität.
Wenn ich mich keuchend, mit besorgniserregendem Puls und übersäuerten Muskeln einen Bergweg hochkämpfe, der eigentlich nur Ziegen oder Gämsen vorbehalten gehört, und jeden Tritt mit Bedacht platzieren muss, um nicht in den Tod zu stürzen, geht mir die Leichtigkeit des Seins etwas abhanden. Gleichzeitig laufen und das Panorama genießen oder die Flora bestaunen, funktioniert nicht, das endet in der Regel auf dem Friedhof. Einmal oben angekommen, verderben die Wolken, die am Morgen noch nirgends waren, die Aussicht, die man gleichzeitig mit zwei Dutzend anderen Wanderer teilen muss. Die Fernsicht ist so oder so von Hochspannungsleitungen, toten Skiliften, Gondelbahnen und sich anbiedernden Ferienhäusern verbaut. Der Weg ins Tal sollte dann ein beschwingtes Vergnügen sein, bei dem man es pfeifend oder ein lustiges Liedlein trällernd laufen lassen kann. Irrtum, spätestens nach fünfhundert Höhenmetern wartet man nur darauf, dass jeden Moment die Kniescheiben davonfliegen. Ich war immer froh, ohne gröbere Gebrechen unten angekommen zu sein. Überlebt man solch eine Bergwanderung, steht am kommenden Tag die Pflege der körperlichen Schäden auf dem Programm, das nennt man dann Ruhetag.
Alles ertragbar, wären da nicht die ratlosen Blicke der Bergbauern. Es ist ihnen anzusehen, wie sie innerlich den Kopf schütteln und sich fragen: Warum quälen sich diese Idioten freiwillig auf den Berg, wenn sie hier oben nicht arbeiten müssen?
Übrigens erkennt der Kenner, dass das Foto einen Bergwanderweg zeigt, und ich habe erreicht, dass wir nächstes Jahr in die Niederlande wandern gehen.
©Daniel Krumm
Juli 2021
ANSPRÜCHE
Ich denke, keinen Mist zu behaupten, wenn ich sage, dass sich mit dem Wohlstand auch die Ansprüche gesteigert haben. Vermutlich werden bald einmal die Menschenrechte neu verfasst, damit der uneingeschränkte 5G-Empfang, das Netflix-Abo, der Besitz eines Smartphones, das Recht auf billiges Fleisch, der Pauschalurlaub mit Flug zum Spottpreis gesetzlich verankert sind und somit eingefordert werden können. So verschiebt sich die Perspektive auf die minimalen Bedürfnisse einer artgerechten Existenz. Ich bin überzeugt, selbst meine Kinder werden staunen, was in zwanzig Jahren als selbstverständlich erachtet wird. Das Recht auf veganes Fleisch, auf ein individuelles Geschlecht oder auf schlechte Fernsehunterhaltung wird in Stein gemeißelt sein. Was heute Verblüffung auslöst, wird irgendeinmal zur Normalität. Ich hätte mir nie träumen lassen, als ich Dieter Bohlen zum ersten Mal singen hörte, dass er mich heute noch nerven würde.
In der Natur der Ansprüche liegt die Schwierigkeit auf deren Verzicht. Was man hat, gibt man nicht mehr her, seien es noch so schlechte Gewohnheiten. Gut sichtbar bei gewissen Kampagnen zu aktuellen Abstimmungen in der Eidgenossenschaft, wo befürchtete Folgen und Abgaben mit dem Komplettverlust an Wohlstand und einer grundlegenden Verelendung gleichgesetzt werden. Ein angeborener Abwehrreflex sieht sofort nur den Verlust und nicht den Gewinn, dabei wären es Entscheidungen für eine nachhaltige Zukunft und für unser eigenes Wohl. Achtung: Wohl und nicht Wohlstand!
Was in meinen Zeilen schwer nach ökologischem Abstimmungskampf riecht, handelt eigentlich nur um das Hinterfragen von Ansprüchen. Noch nie mussten wir so wenig Arbeitszeit für die Grundbedürfnisse aufwenden, noch nie stand uns so viel Geld für die Ansprüche jenseits des Existenzminimums zur Verfügung. 1966 mussten wir 49% des Einkommens für Nahrung und Bekleidung ausgeben, heute sind es noch 16% (Quelle: Lebenshaltungskosten, Avenir Suisse). Die Kosten für das Wohnen blieben während den vergangenen fünfzig Jahren ungefähr stabil, so kann davon ausgegangen werden, dass ein beträchtlicher Teil dieses freigewordenen Drittels unseres Einkommens im Schlund unserer modernen Ansprüche verschwindet. Oje, jetzt wird’s moralinsauer, werdet ihr denken. Ja, richtig, jetzt erlaube ich mir, eine Spaßbremse zu sein, und frage euch: Wieso nicht auf einen kleinen Teil des unnötigen Wohlstands verzichten und ihn in eine umweltbewusste Zukunft investieren?
Ich würde sogar etwas bezahlen, um Dieter Bohlen loszuwerden.
©Daniel Krumm
Mai 2021
GLATTEIS
Kürzlich stand ich vor dem Schaufenster eines Bettwarenhändlers und betrachtete ratlos dieses Plakat.
Meine lieben Freund*innen, ich muss zu meiner Schande eingestehen, dass ich keine Ahnung hatte, was das d bei der Geschlechterbezeichnung zu bedeuten hat. Inzwischen habe ich mich schlaugemacht und herausgefunden, dass d für divers steht und damit ein drittes Geschlecht gemeint ist. Allerdings gibt es noch weitere Abkürzungen für ein drittes Geschlecht: i für inter, a für andere oder einfach nur x. Ich denke, diese Erklärung ist nicht vollständig, man redet schließlich auch von transsexuell und nonbinär. All die Menschen sind nicht zu beneiden, die sich für ihr Geschlecht zu rechtfertigen haben oder sich diesbezüglich nicht in Schwarz oder Weiß einordnen lassen möchten.
Ja, mein Nichtwissen ist eine Blamage, zeigt es wieder einmal, wie ungenügend sich weiße Männer mit reifem Jahrgang in Genderthemen auskennen oder auskennen wollen. Was zu unserer Zeit nicht relevant war, sollte heute auch kein Thema sein. Punkt Schluss. Kein Wunder stehen wir Alten mit dieser Einstellung unter Generalverdacht. Ihr hört zwischen den Zeilen einen verschämten Hauch von Schuldbewusstsein, trotzdem sehe ich in mir keinen bedingungslosen Kämpfer für eine genderneutrale Gesellschaft. Und dies nicht aus altersbedingtem Starrsinn oder auf ein trotziges Gewohnheitsrecht pochend. Mich irritiert die überreizte Sensibilität dieses Themas und seit jede Veröffentlichung und Kommunikation einer akribischen Prüfung unterworfen wird, fühle ich mich auf verdammt dünnem Glatteis. Entweder rutsche ich aus oder breche ein. Selbst ich, der ich gewohnt bin, mit Worten zu arbeiten, komme an meine Grenzen. Als Werktätiger in Staatsdiensten erhielt ich kürzlich von der Abteilung Gleichstellung Unterricht in gendergerechter Sprache.
FALSCH: «Niemand darf aufgrund seiner politischen Überzeugung benachteiligt werden.»
RICHTIG: «Niemand darf aufgrund der politischen Überzeugung benachteiligt werden.»
FALSCH: «Behandlung beim Zahnarzt»
RICHTIG: «zahnärztliche Behandlung»
Worte auf der Goldwaage! Da war die Umstellung auf die neue deutsche Rechtschreibung das reinste Vergnügen. Glaubt mir, wie der Verfasser dieses Stellenplakates, werden wir immer wieder an dieser hohen Messlatte scheitern. Und wenn ihr auf dem Foto genau hinschaut, könnt ihr rechts erkennen, dass die diskriminierende Berufsbezeichnung durch die Genderpolizei bereits korrigiert wurde. Zack, und schon bekommt man eine geklebt!
Nun hoffe ich, dass mich diese Zeilen nicht auf den medialen Scheiterhaufen bringen, sondern zu verstehen geben, dass mich die genderneutrale Sprache in meiner freien Ausdrucksweise diskriminiert. Dagegen protestiere ich in aller Form!
©Daniel Krumm
April 2021
BILDUNGSOFFENSIVE
Die Stadt, in der ich lebe, hat 2017 begonnen, die wunderschönen alten, emaillierten Straßenschilder durch neue zu ersetzen, welche gleichzeitig die Erklärung des Straßennamens mitliefern. Ein Projekt, das 1025 Straßen, Gassen, Wege, Plätze betrifft und gut 100’000 Franken kosten soll. Ob dieses Geld mit dem Schildertausch sinnvoll angelegt wurde, sei dahingestellt, aber man lernt doch einige Feldherren, Politiker, Maler, Dichter und Denker, kaum Frauen, dafür Orte, Flurnamen und Pflanzen kennen.
Na ja, ehrlich gesagt, geht es mir damit wie bei einem Museumsbesuch. Ich lese die Erklärung des Exponats und beim nächsten Schildchen habe ich bereits wieder vergessen, was ich vorher gelesen habe. Ein Beispiel eines Straßenschilds, welches sich bereits nach fünf Metern aus meinem Kopf verflüchtigt hat:
Bungestrasse Gustav von Bunge (1844–1920), Arzt und Sozialmediziner (Abstinenzbewegung)
Allerdings fand ich auch Erklärungen, auf die ich niemals gekommen wäre:
Ackerstrasse Vermutlich Hinweis auf die landwirtschaftliche Vergangenheit der Gegend
Nicht vergessen darf ich jene Straßenschilder, die mit einer unerwarteten Erklärung zu überraschen wissen:
Bernerring Bern, schweizerische Bundesstadt und Hauptstadt des gleichnamigen Kantons
Jedoch die erstaunlichsten Schilder mit Anmerkungen sind jene auf den Fotos. Ich bin sogar etwas sprachlos. Ich hatte schon immer den Verdacht, dass wir Bürger von der staatlichen Exekutive nicht so richtig ernst genommen werden, aber dass man uns für dämlich hält, ist leicht irritierend. Hat denn das Bildungssystem der Stadt derart versagt? Ich lasse diese Frage im Raum stehen, denn bei der Recherche zu diesen Straßenschildern fand ich heraus, dass diese beiden Schilder gar keine Erklärungen haben dürften. Es existiert auf der städtischen Internetplattform ein Verzeichnis der Straßennamen mit den Erklärungen und siehe da, den beiden obigen Schildern fehlen die Erklärungen. Man erklärt auch den Grund der fehlenden Erklärungen, man schreibt, diese Straßennamen seien selbsterklärend.
Aha! Da hat jemand die regierungsrätliche Weisung nicht verstanden?
Darum, meine lieben Freund*innen, sollten wir der kantonalen Bildungsoffensive dankbar sein, denn sie schenkt uns nicht nur Bildung, sie offenbart uns auch deren Mangel.
©Krumm, Daniel
April 2021
TOTALAUSVERKAUF
Meine lieben Freunde, ich bin seit der Kindheit, also schon seit geraumer Zeit, ein enthusiastischer Anhänger des FC Basel, dem Club meiner Stadt. Vermutlich riskiere ich mit dieser Beichte, dass einige Leser, genervt oder verständnislos mit den Augen rollend, ihr Interesse an diesen Zeilen verlieren. Aber hört doch zu, was ich zu sagen habe!
Was ihr hier seht, ist das Mahnmal für einen Fußballverein, der vor Jahren dem süßen Duft des Erfolgs erlegen ist. Diese Verlockung war eigentlich gar keine, denn wünschte der Club, nicht in die provinzielle Bedeutungslosigkeit abzudriften, musste er sich der Kommerzialisierung des Sports ergeben. Der FC Basel war darin über viele Jahre erfolgreich, heute nicht mehr. Erste sportliche und strukturelle Auflösungserscheinungen und der dunkle Schatten ausländischer Investoren verdüstern die Sicht der Fans auf das aktuelle Spiel. Ein simples Spiel mit Emotionen, Stolz und Loyalität wird plötzlich auf dem glatten und nüchternen Parkett der Finanzwelt ausgetragen.
Der Fan ist zu Recht empört, allerdings verschloss er auch die Augen vor der Realität und ließ sich lange Zeit vom Erfolg blenden. Der Weg dieses Vereins unterscheidet sich kaum von jenem einer bekannten Warenhauskette (Name der Redaktion bekannt), die in früheren Zeiten ein stolzes und erfolgreiches Schweizer Unternehmen gewesen war. Dann wurden diese Warenhäuser von einem Konzern (Name der Redaktion bekannt) geschluckt und siehe da, langsam ging es bergab. Irgendwann war man sich in diesem Konzern den Warenhäusern überdrüssig und verscherbelte sie an einen Investor (Name der Redaktion bekannt) der nun die Filetstücke behält und den unrentablen Rest verramscht. Steht am Schaufenster TOTALAUSVERKAUF angeschrieben, dann wisst ihr, dass dieses Geschäft keine Rendite abwarf. Die Maschine der Marktwirtschaft funktioniert so.
Aber liefern nicht WIR den Treibstoff, den diese Maschine zum Laufen bringt? Bevor ich mit erhobenem Zeigefinger zu moralisieren beginne und unser modernes Konsumverhalten mit ätzendem Kommentar überschütte, wende ich mich wieder dem Fußball zu.
Liebe Fans des FC Basel oder wie die ambitiösen Vereine alle heißen! Lasst uns abkehren von den Träumen der Meisterschaft, dem Griff nach den Sternen, dem Glanz des Ruhms und kehren wir zurück zu den Wurzeln des Spiels, zurück in die Nationalliga B, wo der einzige Sponsor der örtliche Elektroinstallateur mit seiner Werbung auf der stolzen Brust der Spieler ist.
Im Moment glimmt noch Licht im Stadion und draußen hängt kein Schild TOTALAUSVERKAUF. Die Götterdämmerung lässt auf sich warten!
©Krumm, Daniel
März 2021
INTELLIGENZTEST
Letzte Woche war Abfuhr von Altpapier und Altkarton. Immer wieder ein Erlebnis der Sonderklasse, offenbart sich doch an solchen Tagen das wahre Gesicht der Gesellschaft. Zeig mir deinen Müll und ich sage dir, wer du bist. Eine Aussage, die hier nur bedingt zutrifft, denn faktisch ist altes Papier und Karton kein Müll. Wir reden hier von Wertstoff, also Stoff, den man der Wiederverwertung zuführt. Der Bürger muss einzig mit einer korrekten Trennung der verschiedenen Stoffe seinen Teil an ein erfolgreiches Recycling beitragen. Man könnte meinen, dies sei keine schwierige Angelegenheit.
Also frage ich mich, was ein ausrangiertes Weihnachtsbäumchen im Altpapier zu suchen hat. Das letzte Mal quoll aus der Kartonschachtel eines Laserdruckers noch Styropor und das vorletzte Mal stand eine Kunststoffverpackung dabei. Aus diesem Grund betrachte ich das Thema Entsorgung als gesellschaftlichen Intelligenztest. Es zeigt sich, ob man in der Schule beim Einmaleins der Materialkunde aufgepasst hat. Offenbar versagt beim Entsorgen das durchschnittliche Denkvermögen. Eine Tatsache, vor der man in vielen Gegenden Frankreichs bereits kapituliert hat und die Leute ihre Wertstoffe, Papier, Karton, Glas, Blech, Alu, PET, Kunststoff in einem einzigen Sack entsorgen lassen. Der Inhalt dieses Sackes wird dann nachträglich von hochqualifizierten Fachkräften sortiert.
Aber dieser Haufen will uns noch etwas anderes mitteilen, erstens, dass kaum jemand weiß, wie man altes Papier und Karton bündelt und zweitens, dass nur wenige Zeitung lesen. Ist das ein Zeichen? Macht Online-Shopping dumm? Sollte mehr Zeitung gelesen werden? Plötzlich erscheinen mir die Bewohner in unserem Haus in einem völlig neuen Licht.
Ja ja, meine lieben Freunde, so ein Papier- und Kartonhaufen lässt tief blicken. Jedes Mal bin ich überrascht, mit welcher Dreistigkeit die Leute ihren überflüssigen Ballast loswerden wollen. Oder sind etwa diese Leute einfach nur zu bequem. Schaut man zur Glassammelstelle, da herrschen dieselben Zustände. Leider wird die Gemeinde irgendwann schwach und räumt die Sauerei auf. So haben die Faulen und Dreisten gewonnen, die Zeit richtet es.
Vielleicht sind sie intelligenter, wie ich meine.
©Krumm, Daniel
März 2021
SINNLOSIGKEIT
Dieses Foto stammt aus einem köstlichen Kurzfilm von Simon Starling, einem englischen Künstler. Er überquerte 2006 zusammen mit einem Freund einen See in Schottland, den Loch Long, in einem kleinen hölzernen Dampfboot. Um die Dampfmaschine anzutreiben, verheizen sie das Boot. Planke für Planke werden demontiert, zerkleinert und in den Ofen gesteckt, dies so lange, bis sie sich nicht mehr über Wasser halten können und mit dem Wrack absaufen. Zum Schluss treiben nur einige Trümmer auf der Oberfläche. Aber nicht genug Wahnwitz, denn vor dieser grotesken Fahrt wurde das Boot auf dem Grund des Sees entdeckt, aus der Tiefe geborgen und restauriert. Welch hirnrissige Aktion! Was mit viel Aufwand gerettet wurde, zerstört man wieder. Ein Kreislauf der Sinnlosigkeit. Okay, Engländer hatten schon immer einen Hang zu exzentrischer Schrulligkeit, weshalb man dies mit britischem Humor erklären könnte. Aber nehmen wir uns die Zeit und betrachten diese Aktion näher, dann staunen wir über deren Botschaft.
Sie verheizen, was sie antreibt und über Wasser hält. Sie zerstören das, was sie aufgebaut haben. Nicht genug, denn da fällt auf, wie kurzsichtig und bequem die zwei sich verhalten. Sie werden untergehen, dem sind sie sich bewusst, aber zu rudern, ist zu anstrengend. Man fährt mal mit Dampf, soweit es geht, und schaut dann weiter.
Es ist klar, das ist eine kritisch humorvolle Auseinandersetzung mit unserer gängigen Haltung zum Umgang mit der Umwelt. So paradox dieser Kurzfilm im ersten Moment erscheint, so treffend ist seine Botschaft. Aber Starling stellt nicht nur die Nachhaltigkeit unseres Denkens und Handelns in Frage, er weist auch darauf hin, dass Technologie nicht zwingend ein Fortschritt darstellen muss. Was bringt eine Dampfmaschine, wenn der Treibstoff ausgeht?
Und somit spanne ich den Bogen zu meinem Lieblingsfeindbild, dem Elektroscooter, das Trottinett für degenerierte Mobilitätskonsumenten. Um ja nicht einige Meter zu Fuß absolvieren zu müssen, wurde ein Gerät lanciert, welches bei der Herstellung eine fürchterliche Umweltbilanz aufweist, welches nur eine Lebenserwartung von wenigen Monaten hat, welches zum Laden von Fahrzeugen eingesammelt werden muss und welches nur sperrig im Weg herum steht. Sinnfreie Technologie, die ich gerne an Stelle des Dampfbootes im Loch Long versenken würde. Das Tragische aber ist, es gäbe noch viele technologische und ideelle Sinnlosigkeiten, die es wert wären, hier erwähnt zu werden. Aber das reicht für heute.
Dieser Kurzfilm heißt übrigens Autoxylopyrocycloboros. Na ja, typisch britisch eben!
©Krumm, Daniel
Februar 2021
ESSGEWOHNHEITEN
Das ist die Liste der beliebtesten Gerichte, die im vergangenen Jahr millionenfach durch eat.ch nach Hause geliefert wurden:
- Pizza Margherita
- Burger
- Pommes Frites
- Cheeseburger
- Pizza Prosciutto
- Tacos
- Pizza Hawaii
- Pizza Prosciutto e Funghi
- Tiramisù
- Döner Box
Auf jeden Fall nichts Gutes! Ich frage mich, ob nicht bereits die Heimlieferung warmer Speisen im Grundsatz eine höchst fragwürdige Angelegenheit darstellt. Ist es nicht sogar ein Verbrechen am verwendeten Lebensmittel als solches? Da werden wertvolle Nahrungsmittel, die aufwändig angebaut, gezüchtet oder hergestellt wurden, zu einem Essen verarbeitet, welches dann lauwarm und pampig beim Konsumenten ankommt und höchstens noch zur genussfreien Kalorienaufnahme taugt. Schade für die Rohstoffe. Einfach ausgedrückt, wenn man keine Ansprüche an die Qualität der Speisen hat, ist der Lieferservice die ultimative Alternative zu einer selbstzubereiteten Mahlzeit.
Aber betrachten wir doch einmal die Hitparade der gelieferten Gerichte. Pizzen sind ja die Lieferklassiker, aber was zu denken gibt, ist die Auswahl. Auf Platz 1 steht das Basismodell, auf 5 mit der Option Schinken und als absoluter Ausdruck der kulinarischen Variationsfreude auf Platz 8 die königliche Ausführung mit Schinken und Dosen-Champignons. Über Platz 7 zu reden, scheint mir sinnlos. Menschen, die sowas bestellen, verwenden für ihre Spaghetti al Sugo vermutlich Ketchup. Da wären die Plätze 2 und 4, die Burger, welche erst mit Corona so richtig zum Lieferhit wurden. Hier kann davon ausgegangen werden, dass mit der Lieferung nicht mehr viel zerstört werden kann. Ah, Platz 3 nicht vergessen! Kalte und welke Pommes Frites, zwanzig Minuten nach dem sie aus dem ranzigen Öl gezogen wurden. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Jeder Kommentar ist Verschwendung. Aber Platz 6 ist ein kleiner Lichtblick. Dieser mexikanischen Spezialität kann doch eine gewisse Finesse zugesprochen werden, trotzdem bin ich sicher, dass auch das im erkalteten Zustand schwer zu verdauen ist. Platz 9 ein köstliches Dessert, welches bei der Lieferung auf der warmen Pizzaschachtel liegt und entsprechend leicht temperiert genossen werden muss. Und auf Platz 10 die Döner Box! Habt ihr mal in solch eine Box geschaut? Als ich es tat, war ich mir nicht sicher, ob das schon einmal gegessen worden war. Alles in eine Schachtel geschüttet und Pommes Frites unten drunter. Wer tut sich denn sowas an?
Meine lieben Freunde, wenn das der kulinarische Spiegel unserer Gesellschaft ist, dann sind wir dem Untergang geweiht. Aber definitiv!
©Krumm, Daniel
Januar 2021
SCHANDFLECK
Jedes Mal, wenn ich an diesem Schandfleck vorbeilaufe, wünsche ich mir, mehr über den Hintergrund dieser, sagen wir mal, eigenwilligen Interpretation von Architektur zu erfahren. Wir Schweizer tendieren ja zu perfektionistischer Korinthenkackerei, weshalb eine derartige Favela-Hütte sogleich ein Nasenrümpfen auslöst und erst recht für Unmut sorgt, wenn es sich seit gefühlter Ewigkeit so präsentiert. Was zu Beginn als unfertiger Bau betrachtet wurde, scheint sich als permanente Unzierde unserer Gemeinde zu etablieren. Das Ganze an der Hauptstraße und nicht etwa in einem Hinterhof.
Eigentlich braucht man die Geschichte dieser Ruine gar nicht zu kennen, denn solch ein Makel existiert in jeder Ortschaft, auf der ganzen Welt. Ich behaupte das mal. Mag sein, dass die Diskrepanz zwischen dem Schandfleck und den schmucken Gebäuden nicht an allen Orten so eklatant ausfällt. Überall gibt es die renitenten Hausbesitzer, die sich einen Scheiß um die minimalen Anforderungen an das Ortsbild scheren. Aber nicht genug. In der Regel pflegen diese Menschen auch eine dazu passende Sauerei um ihr Gehütt, dass der Gesamtanblick erst recht schmerzt.
Aber wie ich diese Unordnung so betrachte, wird mir klar, dass dies kein Schandfleck ist, sondern ein Denkmal. Denk mal nach, will es uns sagen, gäbe es mich nicht, dann sähe der Rest nicht so hochwertig aus. Erst meine Hässlichkeit macht euch zu Schönheiten. Gäbe es mich nicht, dann wären alle anderen Häuser mit ihrer spießigen Ordnung nur langweilige Ödnis. Unsere Orte hätten die Monotonie nordkoreanischer Plattenbauten. Ab und zu ein Misthaufen zwischen den Rosen schadet nichts. Allerdings stellt sich die Frage, ob ich mit meiner Erkenntnis nicht völlig falschliege und der Schandfleck gar kein Denkmal, sondern ein Mahnmal ist. Es mahnt uns vor zu viel Perfektion.
Jetzt verstehe ich auch, weshalb er nicht aufräumt, denn nur so kommt sein Adventskranz an der Tür zur Geltung.
©Krumm, Daniel
Dezember 2020
GIG-ECONOMY
Ich bin kein Freund von Anglizismen, weil sie mich oft als uncoolen Deppen dastehen lassen, da ich zero Ahnung habe, was sie bedeuten. Solch eine Blamage widerfuhr mir, als ich fragte, was für ein Tag der Hashtag sei. Da ich nicht gerne als einen Oldie abgestempelt werden will, versuche ich seither, jede neue Wortkreation, die am Horizont aufpoppt, sogleich zu klären. So kann ich bei Bedarf mit einer hippen Wortwahl brillieren.
Diese Woche las ich in der Zeitung von der Gig-Economy und machte mich auf der Stelle schlau. Und wieder einmal staunte ich, wie sich ein negativer Begriff auf Englisch erheblich positiver anhört. Influencer hört sich doch besser an wie Produktevertreter, Chillen viel cooler als Faulherumhängen, Nordic Walking entscheidend sportlicher denn Laufen an Stöcken.
Aber Achtung, jetzt kommt der Shitstorm!
So erscheint Gig-Economy enorm netter als Billigabsahnen. Mittlerweile funktioniert ein ganzer Wirtschaftszweig dank Arbeitskräften, die in einer nebulösen Grauzone arbeiten. Zum Beispiel Uber mit ihren Fahrern und Essens-Kurieren. Und wir wissen alle, dass diese Leute miserabel bezahlt werden, keine soziale Absicherung und keine Versicherungen haben. Zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Die machen das ja freiwillig, hört man sagen. Na ja, mehr oder weniger. Lieber schlecht, statt gar nichts verdienen, rechtfertigen sich diese Leute und greifen fatalistisch nach dem Strohhalm und glauben hoffnungsvoll dem Versprechen auf Selbstständigkeit und Freiheit.
Aber wisst dir was? Uber verdient sich an diesem System dumm und dämlich. Ein Beispiel? Für vier Pizzas im Wert von 100.- Fr. erhält der Pizzakurier von Uber Eats für das Ausliefern 8.50 Fr. und Uber sackt dafür 30.- Fr. ein. Die Wartezeit wird selbstverständlich nicht bezahlt und die meiste Zeit verbringt der Kurier mit Warten.
Die Konzerne der Gig-Economy sind die Blutegel der Wirtschaft. Das Vermitteln von Produkten und Dienstleitungen und das damit verbundene Aushöhlen der Wertschöpfungskette ist ihr Geschäftsmodell. Uber, Alibaba, Amazon, Booking.com, Airbnb, Zalando und all diese Plattformen tragen kaum etwas zur Volkswirtschaft bei, sie schöpfen nur die Sahne von der Milch ab und verstopfen die Straßen mit Paket- und Kurierfahrzeugen. Ein dominantes System, welches sich an unserer Bequemlichkeit, Ungeduld und Kurzsichtigkeit bereichert.
So, denen habe ich es jetzt aber gegeben! Das war kein Shitstorm, das war bereits ein Bashing!
©Krumm, Daniel
Dezember 2020
INTOLERANZEN
Da gibt es diverse Intoleranzen, unter denen ein Mensch leiden kann. Die Medizin spricht von einer Stoffwechselstörung, deren Ursache ein Enzymdefekt oder ein Enzymmangel sein kann und allergische Reaktionen zur Folge hat. Als Beispiel sei die Laktose-Intoleranz aufgeführt, die den Genuss von Milchprodukten zum Alptraum der Gedärme werden lässt. Wenn man das Thema Intoleranzen bei Wikipedia überfliegt, stellt man fest, dass es kaum etwas gibt, gegen das man nicht intolerant sein kann. Unser Körper ist offensichtlich nicht mit allem einverstanden, was ihm tagtäglich zugemutet wird. Interessant ist auch die Tatsache, dass die Intoleranzen nicht weltweit gleich verteilt sind und keine Modeerscheinung darstellen. Selbst Ötzi, die 5000 Jahre alte Gletschermumie, war laktoseintolerant, wie man bei Genuntersuchungen herausfand.
Trotzdem mache ich mir meine Gedanken zur Entwicklung der Intoleranzen, kann ich mich doch beim besten Willen nicht erinnern, dass derartige Begriffe früher ein Thema waren. Aber vielleicht liegt es nur an neuen Begrifflichkeiten, wieso man etwas plötzlich wahrnimmt. Das Burnout war einst eine Erschöpfungsdepression und eine Intoleranz eine Allergie. Die wachsende Häufigkeit solcher Erscheinungen dürfte jedoch der gesellschaftlichen Entwicklung und nicht der Evolution geschuldet sein. Das behaupte ich mal einfach so.
So komme ich auf das obige Foto zu sprechen, welches nämlich ein ähnliches Phänomen dokumentiert. Man kann über die Qualität dieses Strassenkunstwerkes seine eigene Meinung haben, man kann es sogar scheiße finden, aber man sollte es nicht zerstören. Das meine ich zumindest. Ein Guerilla-Sprayer aus der militanten Szene war nicht dieser Meinung und brachte es mit roter Farbe zum Ausdruck. Die Medizin spricht hier von einem klassischen Auswuchs der akuten Respekt-Intoleranz, eine Erscheinung, der man immer öfter begegnet. Was einem nicht passt, wird kaputt oder schlecht gemacht. Angefangen bei einem gewissen D.T. aus den USA (Name der Redaktion bekannt), über religiöse Fanatiker bis hin zu einem radikalen Sprayer kann eine klare Tendenz zur Respekt-Intoleranz festgestellt werden. Ein Trend, einer Abwärtsspirale gleich, der nichts mit defekten Enzymen, vielmehr mit defekten Gesinnungen zu tun hat. Oder so.
Übrigens, meine Intoleranz beginnt bei der Intoleranz!
©Krumm, Daniel
November 2020
ALTERNATIVDESTINATION
Diese Zeilen schreibe ich mit Scham und dem Wunsch zur Wiedergutmachung. Was hier wie Beichte und Busse daherkommt, soll euch zeigen, dass das Verhalten der meisten von uns in diesem Jahr der Fahne im Wind gleicht. Enttäuscht nahm man wahr, wie das geliebte Urlaubsziel zum Seuchengebiet mutierte, also brauchte es eine Alternativdestination. So suchte man quasi nach einem Ersatz, einem Notbehelf. Nur für dieses Jahr, im nächsten werden wir wieder in den Süden pilgern, in die Ferne schweifen, an den Stränden herumliegen, um Inseln herum tauchen, mit riesigen Schiffen reisen, werden wir wieder Sangria aus Kübeln saufen, Sonnenbrände davontragen, in Massen Sehenswürdigkeiten überfluten, sich durch Buffets fressen und sich animieren lassen. All dies ist heuer nicht möglich. Schade!
So erging es auch uns. Wohin, wenn nicht ins sonnenüberflutete und weinselige Languedoc? Unser Notbehelf war das Engadin. Zwei Wochen werden wir uns da schon beschäftigen können, dachten wir uns und reisten ohne überzogene Erwartungen nach Scuol.
Nun, meine lieben Freunde, ihr werdet es nicht glauben, aber ich denke, in den beiden Wochen zu einem besseren Menschen geworden zu sein. Ja, ohne Scheiß! Denn ich erkannte, dass es keine Alternativdestinationen gibt. Dafür ist das Engadin zu atemberaubend. Nicht weil mir beim Wandern bergauf meist die Luft wegblieb, vielmehr ist damit die Wirkung beim Anblick dieser Berg- und Naturwelt gemeint. Schlichtweg grandios. Abgesehen von den körperlichen Strapazen und dem Umstand, dass sich partiell die Haut von meinen Füssen löste, erwarteten uns eindrückliche Eindrücke und maßloses Staunen. Stichwort: Nationalpark! Aber auch die Gastfreundschaft, die Qualität des Essens und die Absenz der Massen sprechen für weitere Besuche des Tals. Kurzum, wir waren begeistert!
Dabei hatte ich allerdings ein unterschwellig schlechtes Gewissen. Ich habe dieses Tal beleidigt, habe ich es doch zur Notlösung degradiert und da war ich mit Sicherheit nicht alleine. Das Tal muss sich fühlen, wie jemand, den man im letzten Moment einlädt, weil jemand abgesagt hat. Zweite Garnitur, Ersatzspieler, Trostpflaster, besser als gar nichts. Aber das hat dieses Tal nicht verdient, definitiv nicht.
Also, ihr herzlichen Engadiner, ich möchte mich für meinen Affront gegenüber euch entschuldigen und mit einer ehrlichen Vorfreude wiederkommen. Jetzt muss ich aber aufpassen, dass das Languedoc nicht eifersüchtig wird.
©Krumm, Daniel
Oktober 2020
STEINMÄNNCHEN
Ich liebe unberührte Natur, in der man urwüchsige Wildnis erleben darf, ohne auf unschöne Auswüchse der Zivilisation zu stoßen. Allerdings ist in unseren Breitengraden und vornehmlich in der kleinräumigen Schweiz die Suche nach authentischer Natur eine gröbere Herausforderung. Da meint man, endlich die stille Abgeschiedenheit eines Waldes in einem verwilderten Tal gefunden zu haben, schon kommt eine lärmende Schulklasse entgegen und weiter vorne führt eine sechsspurige Autobahn vorbei.
Wieder einmal dachte ich, solch einen unbefleckten Ort in der Natur entdeckt zu haben. Ein Bächlein, welches sich in einem schmalen Juratal zwischen Steinen durchwindet, von Felsen stürzt und sich in Mulden sammelt. Über allem ein weicher Bezug aus Moos, dekoriert mit Farnen. Einzig das Murmeln des Wassers und ein Vogel im Geäst sind zu hören.
Aber leider standen da diese Steinmännchen und sogleich trübte sich die Freude an diesem idyllischen Plätzchen mächtig ein. Ich muss mich beherrschen, um nicht die untersten Steine wegzukicken, damit diese Mahnmale der menschlichen Einfältigkeit kollabieren und nicht mehr diesen wunderschönen Ort entweihen. Ich habe sie stehengelassen. Vielleicht gab es einen Funken Respekt vor dem zugegebenermaßen kunstvoll und kühn aufgetürmten Gebilde. Trotzdem empfinde ich solche Konstrukte als optische Umweltverschmutzung und erinnern mich schwer an Hunde, die ihre Präsenz mit einem Strahl Pisse markieren müssen. Oder sind es eventuell okkulte Zeichen? Vielleicht fanden hier unlängst spiritistische Messen oder gar Hexenverbrennungen statt? Blödsinn! Macht man sich über diese Steinmännchen schlau, dann findet man tatsächlich historische Hintergründe, die von Wegmarkierungen über Vermessungspunkte bis zum Wohnsitz guter Geister berichten.
Unweigerlich kommt mir der touristische Grundsatz in den Sinn: Mit dem Massentourismus verliert jede paradiesische Destination ihre Schönheit. In dieses idyllische Tal finden nur wenige Leute und doch reicht es, um Spuren zu hinterlassen, die stören. Ist denn das nötig?
Aus meiner Sicht nicht, darum gab ich einem weniger effektvoll aufgetürmten Steinmännchen einen vernichtenden Tritt und setzte verbissen die Suche nach der unberührten Natur fort.
©Krumm, Daniel
September 2020
ALLEINSEIN
Plötzlich steht diese Rotbuche ganz alleine da. Sie wirkt ein wenig zerzaust und verloren. Der Holzschlag des Winters hat sie verschont, denn der Borkenkäfer liebt einfach keine Rotbuchen. Egal, aber Tatsache ist, dass sich ihre Perspektive auf die Welt völlig verändert hat. Vorher musste sie sich auf die Zehenspitzen stellen, um einen Blick ins Tal zu erhaschen, jetzt ist sie über alles erhaben und die aufdringlichen Fichten sind weg. Man sieht es ihr an, sie stand ihr Leben lang eingeklemmt zwischen den anderen Bäumen und musste sich behaupten. Da gab es kaum Raum zur Entfaltung und wollte sie ans begehrte Licht, dann hatte sie Leistung zu erbringen. Wer nicht wuchs, verkümmerte im Schatten. Aber jetzt ist sie Königin des Waldes. Sie blickt auf den niederen Bewuchs und die angefressenen Baumleichen hinab und fühlt sich erhaben.
Alles hat sich verändert und sie wäre unendlich glücklich, gäbe es da nicht einige Probleme, die sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht kannte. Der Wind! Seit sie alleine dasteht, reißt er an ihr herum, zerrt an den Ästen, bringt sie bedrohlich zum Schwanken und die Wurzeln haben größte Mühe, verankert zu bleiben. Niemand da, an den man sich anlehnen kann. Und die Sonne! Sie brennt erbarmungslos auf die dünne Borke, dass sie droht aufzuspringen, wie die Wurst auf dem Grill. Nirgends Schatten. Als läge sie wie eine nackte Rothaarige ohne Sonnencreme und ohne Sonnenschirm den ganzen Tag am Strand.
Die Gemeinschaft hat halt auch seine guten Seiten, man ist nicht so allein. Darum bin ich überzeugt, dass diese Rotbuche die Vorzüge des Kollektivs schnell erkannt hat. Zu spät! Eine menschliche Entscheidung oder eine natürliche Katastrophe hat sie unverhofft in die Isolation gestellt. Wer kennt das nicht? Da stirbt jemand weg, da wird man verlassen, da wird man entlassen und schwupp, schon ist man einsam. Und man ist höchst selten darauf vorbereitet, wie diese Rotbuche, sonst hätte sie sich rechtzeitig kräftige Wurzeln, eine dicke Borke oder schattenspendende Äste zugelegt.
Ja, meine lieben Freunde, was will uns das Schicksal dieser Rotbuche sagen?
Ganz einfach: Nehmt euch in Acht, der Wald ist nicht so nett, wie ihr meint. Da geht es oft sehr menschlich zu.
©Krumm, Daniel
August 2020
ALLMEND
Mit dem Begriff Allmend bezeichnen wir bei uns in der Schweiz den öffentlichen Raum, also jene Flächen, die der Allgemeinheit gehören und nicht in privatem Besitz sind. Ein Beispiel solch einer Fläche ist der Bürgersteig. Bereits das Wort symbolisiert den öffentlichen Charakter. Nun stelle ich fest, dass viele Bürger die Eigentumsverhältnisse solcher Flächen neu interpretieren. Streng betrachtet, kann man als Steuerzahler durchaus einen Anteil am öffentlichen Gut sein Eigen nennen. Auch ich habe manchmal das Gefühl, mit meinen Steuern wieder einmal eine ganze Straße gekauft zu haben. Hahaha, kleiner Scherz, dieser Betrag reicht knapp für einen Gullydeckel. Entschuldigt, ich schweife ab.
Dieses Foto ist nur ein Beispiel, wie die Allmend immer mehr von den Bürgern annektiert wird. Man könnte meinen, das Volk holt sich zurück, was ihm gehört. Oder sozialer ausgedrückt: Lasst uns teilen! Solch ein wunderbarer E-Scooter - für mich persönlich die absolute Krönung der Mobilität - ist ja ein perfektes Beispiel für unsere soziale Gesellschaft, denn damit teilt man nicht nur das Gerät, sondern auch dessen Abstellplatz mit anderen Bürgern. Einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn zeigen auch jene großzügigen Menschen, die ihre unnützen Güter auf den Bürgersteig stellen und mit GRATIS anschreiben. Irgendjemand kann den kaputten Bürostuhl oder so sicherlich gebrauchen, man muss ihn nur lange genug stehen lassen. Sonst holt ihn der Gemeindearbeiter, welcher in der Regel nicht so wählerisch ist. Eine bezaubernde Entwicklung ist auch das Müll-Sharing. Man teilt sich den Müll, damit wir alle etwas davon haben. Zu genießen in Parks, an Grillstellen, an idyllischen Ufern oder an Recycling-Sammelstellen. Die Sozialisation der Allmend ist nicht mehr aufzuhalten. Privatsphäre und Öffentlichkeit wird sich durchmischen, Besitz bekommt einen anderen Status. Wir teilen alles, wenn es sein muss auch den Ehepartner, man will ja nicht egoistisch und besitzergreifend sein.
Liebe Freunde, die Zeiten ändern sich, was bedeutet, dass ihr euch darauf vorbereiten müsst. Überlegt in Zukunft reiflich, was ihr kauft. Denkt immer daran, es sollte auch der Öffentlichkeit gefallen. Keine spleenigen Anschaffungen, die selbst die Müllabfuhr stehen lässt, nur keine Geschmacksverirrungen, die die Allmend versauen. Vielen Dank für euer Verständnis!
©Krumm, Daniel
Juli 2020
SCHALTGETRIEBE
Liebe Freunde, das Schaltgetriebe droht auszusterben. Na und, werdet ihr denken, dieser Umstand hat längst nicht die Tragik, wie der Verlust einer Tier- oder Pflanzenart. In der globalen Natur stehen 26‘000 Arten vor dem Aussterben und ich komme mit diesem vorsintflutlichen Schaltgetriebe. Ja, ein miserables Sinnbild, denn Mechanik kann nicht aussterben, sie verschwindet einfach, weil sie technisch überholt und nicht mehr gefragt ist. Aber das Schaltgetriebe sehe ich als Symbol für das langsame Verschwinden einer Generation, womit der Zusammenhang zum Aussterben wieder gegeben wäre.
Der Untergang des Schaltgetriebes ist nicht mehr aufzuhalten, zumindest aus der Sicht meiner erwachsenen Kinder. Für sie sind das dauernde Umrühren von Zahnrädern mit einem Knüppel und das feinfühlige Pedalspiel etwa so antiquiert wie der Gebrauch eines Kassettenrekorders. Betrachtet man ihre Argumente aus objektiver Sicht, dann sollte meine Sympathie für das Schaltgetriebe wie ein Tropfen Wasser auf einem heißen Stein verdampfen. So ein modernes Automatikgetriebe optimiert die Motorenleistung und den Verbrauch, entlastet die Person hinter dem Steuer von unnötigen Aufgaben, erhöht damit die Verkehrssicherheit und verhindert hässliche Verschalter mit kapitalen Getriebeschäden. Und dann führen die Automatikliebhaber ihr stärkstes Argument ins Feld: Im heutigen Langsamverkehr führt das ewige Kuppeln zu einem Tennisarm am Bein. Alles Weicheier und Faulpelze! Ich könnte jetzt von früher erzählen, als die Getriebe gar nicht synchronisiert waren und die Steuerung keine Servounterstützung hatte, aber davon sehe ich mal ab, sonst verdrehen alle wieder die Augen.
Aber lasst uns doch über Emotionen reden. Ja, im Ernst, das Bedienen eines Schaltgetriebes hat etwas mit Emotionen zu tun. Es mag seltsam klingen, wenn man der Mechanik Gefühle entgegenbringt, aber Hand aufs Herz: Wer hat nicht manchmal fragwürdige Gefühle zu Dingen? Da gibt es Menschen, die den Ton ihres Motorrads lieben, oder solche, die feuchte Augen beim Anblick ihres Rennrades bekommen, oder jene, die dem Besitz ihres Traumhauses alles unterordnen. Dinge können Emotionen auslösen. Bedenklich würde es erst, wenn daraus wahre und innige Liebe erwüchse.
Keine Sorge, ich liebe mein Auto und dessen Schaltgetriebe nicht, aber ich finde es eine geile Sache, aktiv am Fahren teilzunehmen, den Puls des Motors zu spüren und auf diese Weise mit der Mechanik ein wenig eins zu sein. Dagegen ist für mich ein Automatikgetriebe wie alkoholfreies Bier, wie Elektrofahrräder, wie Sex mit einer Gummipuppe oder so.
©Krumm, Daniel
Juli 2020
COOLNESS
Es hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass ich bereits einige Kilometer auf dem Zähler habe und einer Generation angehöre, die gerne mit einem sentimentalen Blick in die Vergangenheit schielt. So sah ich neulich dieses Foto von Steve McQueen und musste neidlos anerkennen, dass er ein absolut cooler Typ war. Cool, ein Begriff aus dem Englischen, auch als Temperaturbezeichnung bekannt, wurde damals für solch eine Klassifizierung noch nicht gebraucht. Man nannte es lässig, souverän, entspannt, abgeklärt, beherrscht und überlegen, nur nicht kühl. Aber cool fasst trotzdem all diese Wesenszüge elegant zusammen, das muss sogar ich, der es mit den Anglizismen nicht so hat, zugeben.
Betrachtet man das Foto genau, dann stellt man fest, dass das Ganze nicht so cool daherkäme, wenn es in der Gegenwart stattfände. Rauchen ist generell ungesund und verpönt, Motorradfahren ohne Helm geht gar nicht und überhaupt wirkt dieses Machogehabe völlig deplatziert. Der Aufnahme haftet ein Hauch von Unvernunft und Verwegenheit an, was es damals gar nicht war, da man sich einfach so benahm. Die ganze Epoche war cool, zumindest aus der jetzigen Sicht. Ist es nicht so, dass Coolness mittlerweile nur mehr als sentimentale Sehnsucht daherkommt. Ist es nicht so, dass jene, die cool erscheinen wollen, meist wie eine schlechte Imitation rüberkommen? Kann man in der heutigen Zeit überhaupt noch cool sein oder fehlen uns die Rahmenbedingungen dazu, weil zwischenzeitig alles reglementiert und moralisch geglättet wurde? Vermutlich löst Steve McQueen mit diesem Auftritt heutzutage nur ein mildes Lächeln mit Kopfschütteln aus. Das passt nicht in unsere Zeit, ähnlich wie die Harley-Fahrer, sofern man deren Authentizität mit den ursprünglichen Vorbildern vergleicht. Entschuldigt liebe Harley-Fahrer, habe ich doch einige in meinem Freundeskreis, lasst euch nicht von meinen wirren Gedanken verärgern. Auch ich träume manchmal den Traum von Freiheit und Coolness. Gemeinsam sehnen wir uns nach etwas, das es kaum mehr gibt.
Und ich sag euch was: Mit einem Elektrofahrrad bei Rot über eine Kreuzung zu brettern, hat nichts mit Coolness zu tun.
©Krumm, Daniel
Juni 2020
ABWÄRTSSPIRALE
Beim Blick durch das Treppenauge ist man sich oft nicht sicher, ob man nach oben oder nach unten schaut. Beinahe ein Trompe-l’oeil, eine perspektivische Irreführung. Solch eine Spirale ist eine dankbare Figur der Geometrie. Diese Linie, die sich um einen Punkt windet und sich je nach Betrachtungsweise entfernt oder nähert, hat ein enormes Potential an fieser Täuschung und bedeutungsschwangerer Symbolik.
Nachdem ich mich im Schloss von Porrentruy diese Treppe hochgeschleppt hatte, äugte ich hinunter und bald wurde es mir schwindlig. Um sogleich falschen Verdächtigungen einen Riegel zu schieben – Alkohol war nicht im Spiel. Auch keine Höhenangst. Womöglich ein leicht tiefer Blutdruck. Ich vermute, der Schwindel hat in erster Linie mit der Verarschung meiner Wahrnehmung zu tun. Bemerkenswert, wie viele Auswirkungen mit der Spirale verbunden sind. Man sagt, dass von einer drehenden Spirale eine hypnotische und von speziellen Spiralen sogar eine verhütende Wirkung ausgehen. Oder die Natur. Da finden wir die Spirale nicht nur beim Schneckenhaus, denn der Farn entrollt elegant seine Blätter aus einer Spirale heraus oder die Sonnenblume ordnet ihre Samen spiralförmig an und ein Wasserwirbel ist auch nur eine Spirale.
Streng genommen ist dieses Treppenhaus eine Abwärtsspirale. Und somit kommt die Symbolik zum Tragen. Ein äußerst negativ befrachteter Begriff, der in einer Gesellschaft, deren Wirtschaftssystem auf Wachstum basiert, nicht existieren darf. Da gibt es nur eine Aufwärtsspirale. Aber jetzt wird es lustig, denn der Begriff Aufwärtsspirale gibt es nicht, ergo auch kein Synonym dazu, während es für die Abwärtsspirale Dutzende gibt. Teufelskreis, Zwickmühle, Eskalation oder Rezession zum Beispiel. Dieses Treppenhaus vermittelt also nur negative Assoziationen, zumindest aus dieser Perspektive. Hätte ich die Aufnahme von unten gemacht, dann wäre es eine Aufwärtsspirale gewesen, die es gar nicht gibt, aber trotzdem ein optimistisches Gefühl vermittelt und mir wäre es nicht schwindlig geworden.
Abwärts und Aufwärts. Pessimismus und Optimismus.
Wahnsinn, was man alles in ein Foto interpretieren kann! Oder ist es eher Schwachsinn?
Eigentlich gefielen mir die Geometrie und die Perspektive, als ich auf den Auslöser drückte, mehr nicht.
Warum muss denn immer alles eine bescheuerte Bedeutung haben?
©Krumm, Daniel
Juni 2020
VERFÜHRUNG
Was hier unter dieser Blüte hängt, ist kein Blatt, das ist ein Schmetterling. Genau genommen, ein Kleopatra-Falter, auch Mittelmeer-Zitronenfalter genannt. Den Namen der Wildblume, aus dessen Blütenkelch dieser Sommervogel den Nektar saugt, konnte ich nicht eruieren. Aber genug über die Flora und Fauna des Languedoc, wenden wir uns der Aussage dieses Fotos zu.
Erst beim zweiten Blick auf das Foto fielen mir bedeutsame Gegensätze auf, welche in der Natur immer wieder zu sehen sind: Gesehen und nicht gesehen werden. Bescheidenheit und Prunk. Wunderschön die Blume, die sich möglichst farbig und duftend zur Schau stellt, damit sie viele Insekten anzieht, während der Schmetterling unauffällig zu leben versucht, um nicht gefressen zu werden. Faszinierend wie er selbst die Äderung des Laubblattes nachahmt. Nicht alle Erscheinungen in der Tierwelt sind so logisch und nachvollziehbar. Der Pfau zum Beispiel. Die Herzen der weiblichen Pfauenwelt liegen all den überbordend prachtvollen Pfauenmännchen zu Füssen, nur kann der narzisstische Idiot kaum fliegen und gilt als bequem zu jagende Delikatesse unter Raubtieren und Menschen in Indien. Überhaupt sind es immer wieder die Männchen der Fauna, die über einen angeberischen Protz verfügen, während dem dies bei der menschlichen Schöpfung gar nicht der Fall ist. Hier sind die Frauen die ästhetische Krönung und wir Männer wurden tendenziell fürs Grobe entworfen.
Zurück zu unserem Foto. Das ist übrigens ein Weibchen, was mich völlig irritiert. Ich stellte mir nämlich vor, wie das Männchen sich von der Blüte verführen lässt. Die Frau - die schöne und betörende Blume, der Mann - das unscheinbare und unterwürfige Insekt.
Wie sang einst Hildegard Knef:
Männer umschwirr’n mich,
wie Motten um das Licht.
Und wenn sie verbrennen,
ja, dafür kann ich nicht.
Somit verhaltet sich die Gattung Mensch widernatürlich. Die unscheinbaren Weibchen bewundern nicht die hinreißenden Männchen, bei uns ist es umgekehrt. Da lief in der Evolution was schief. Die Frage ist nur, entwickelte sich unsere Spezies oder die Tierwelt in die falsche Richtung?
Ich weiß es nicht, habe aber einen Verdacht.
©Krumm, Daniel
Mai 2020
POPULATIONSREGULIERUNG
Hilfe, wir saufen ab! Was zu Beginn noch ganz lustig war, wird langsam zur Bedrohung. Unser System nimmt Schaden, kehren wir nicht bald zur Normalität zurück.
Ich frage mich, wieso man diesem Virus nicht freien Lauf gelassen hat. Die Gesellschaft wäre auf natürliche Weise entschlackt worden, so, wie es in der Regel die Natur regelt. Die Alten stehen eh nur im Weg rum, schwächen unsere Altersvorsorge, treiben die Krankenkassenprämien in die Höhe, verschwenden ihr Vermögen und werden so oder so viel zu alt.
Aber ich, ein Wesen im Dunstkreis der Corona-Risikogruppe und nur wenige Jahre von der Schwelle zur wirtschaftlichen Nutzlosigkeit entfernt, verspreche euch, mich rechtzeitig in eine einsame Höhle zurückzuziehen, um dort demütig auf mein Ableben zu warten. Wie früher die alten Indianer. Wir brauchen keine Altersheime, einige Höhlen abseits der Zivilisation reichen völlig aus.
Nur pragmatische Lösungen werden uns den Wohlstand sichern!
©Krumm, Daniel
Mai 2020
HARTNÄCKIGKEIT
Die Geschichte dieser beiden Störche ist ein Drama. Aber zuerst die Vorgeschichte.
Im Zoo von Basel wird das 1927 erbaute Vogelhaus saniert und erweitert. An und für sich eine lobenswerte Angelegenheit, gehe ich davon aus, dass die Haltung der Tiere damit verbessert wird. Und genau diese Tatsache wird diesem Storchenpaar zum Verhängnis.
Während vielen Jahren brütete dieses Paar auf einem Kamin, welches gleich neben dem Vogelhaus stand und vor einigen Wochen abgerissen wurde. Die Störche widersetzten sich förmlich dem Abriss, indem sie, ungeachtet der staubigen und dröhnenden Arbeiten, weiterhin ihr Nest bauten. Nun ist der Kamin weg und seither versuchen sie, mit unerschütterlicher Hartnäckigkeit ihr Nest auf dem Dachrand daneben zu bauen. Sinnlos! Es funktioniert nicht, die Äste rutschen immer wieder vom Dach. Tag für Tag bauen sie ein Nest, welches nie eines werden kann. Mein Weg zur Arbeit führt an dieser Baustelle vorbei und lässt mich an diesem Drama teilhaben.
Aber die Krönung des Dramas erlebte ich, als ich nach der Aufnahme dieses Fotos nochmals hinschaute und Zeuge wurde, wie das Männchen auf das Weibchen sprang und es begattete. Diskret wie ich bin, machte ich davon kein Foto. Interessant war aber zu sehen, wie er mit seinen langen Beinen zurechtkam und dass er sich bei der Dauer des Geschlechtsakts durchaus am durchschnittlichen Mann messen kann. Das nur nebenbei. Die Sinnlosigkeit dieses Liebesakts betrübte mich. Wo sollen denn die Eier liegen, wenn es kein Nest gibt? In der Dachrinne? Hatte das Männchen nur sein Vergnügen im Sinn, respektive war er aus lauter Lust von Sinnen?
Egal, die beiden setzten ihren sinnlosen Nestbau weiter fort, Tag für Tag. Und es sieht immer noch gleich aus. Manchmal stehen sie einfach nur da, als denken sie über ihre Situation nach. Aber sie geben nicht auf. Traurig, aber auch bewundernswert, denn sie glauben an ihr Ziel. Großer Respekt! Da fällt mir ein Zitat von Luther ein, der in einer ähnlich schwierigen Lage gesagt haben soll:
Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen.
Ich werde an diese Störche denken, wenn ich wieder einmal an der Menschheit und insbesondere an mir zweifle.
©Krumm, Daniel
April 2020
SCHIEFLAGE
Erstaunlich, wie schnell alles in Schieflage geraten kann. Die Lokomotive schoß über ihr Ziel hinaus und steckte Sekunden später leicht ramponiert in der Rue de Dunkerque (Gare du Nord, Paris, 1895). Ein Sinnbild für unsere momentane Lage. Es geht nicht um den Corona-Virus, es geht um dessen Auswirkungen.
Über Corona zu hadern, macht keinen Sinn. Höhere Gewalt gehört in die Kategorie Schicksal und kann nicht verhindert, höchstens angemessen bekämpft werden. Klammert man allerdings die Ursache aus und betrachtet deren Wirkung, dann sieht es schon ein wenig anders aus. Hierzu gäbe es von unzählig interessanten Erkenntnissen über den Menschen als Individuum und die Gesellschaft als Gefüge zu berichten.
Ein System auf tönernen Beinen, die beim ersten Beben wegbrechen. Kaum werden Wirtschaftszweige heruntergefahren, schon erhebt sich ein jämmerliches Wehklagen und die Ersten schreien sogleich nach Unterstützung und prophezeien eine sofortige Insolvenz. Ich bin irritiert, dass wenige Tage nach dem Lockdown ein derartig hysterisches Geschrei losbrach. Keine Frage, da trifft es einige brutal hart, vernichtend, schuldlos und völlig auf dem falschen Bein. Nicht lustig. Trotzdem ist es erschreckend, wie ein Teil der Wirtschaft auf dünnem Eis wandelt. Keine Reserven, keine Rückstellungen, keine Liquidität, dafür Verschuldung, hohe Fixkosten, hohe Risiken und vermutlich nicht wenige Luftschlösser. Ein Zeichen niedriger Zinsen und guter Konjunktur. Wachstum nährt unseren Wohlstand, die Wirtschaft blüht und nichts kann uns passieren. Wir schreien: „Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke!“
Plötzlich werden wir still und murmeln: „Oh, Shit!“, und schauen uns bedröppelt an. Da schwimmen uns soeben die Blüten des Wohlstands davon, der Motor stottert, hustet, droht abzusterben. Illusionen werden in Frage gestellt, allerdings nur so lange, bis der Motor wieder auf Touren kommt. Ich bin gespannt, welche Lehren wir aus dieser Krise ziehen.
Übrigens hatte ich meinen persönlichen Lockdown vor 21 Jahren. Als Kleinunternehmer hatte ich einmal zwei rabenschwarze Monate, während denen ich unfallbedingt nicht arbeiten konnte. Kein Einkommen, keine Versicherung, keine Kurzarbeit, keine Unterstützung, nichts. Wir assen den Kitt von den Fenstern, vermieteten die Kinder als Erntehelfer, meine Frau ging mit selbstgemachten Nudeln auf den Schwarzmarkt und ich bot vom Lazarett aus Telefonsex an. Und wisst ihr was? Wir gingen gestärkt und um eine Erfahrung reicher aus dieser Krise hervor.
©Krumm, Daniel
April 2020
MADE
Je länger ich über die existentiellen Probleme der Menschheit brüte, desto mehr neige ich zu einer Einsicht, die vermutlich so alt ist wie die Existenz der Menschheit selbst: Wohlstand macht faul, bequem und begierig! Nichts Neues, wenn man ehrlich ist, nur erstaunlich, dass wir diese Tatsache hartnäckig ausblenden. Wir wollen nicht hören, dass uns der Wohlstand zu fetten Maden im Speck formt, die kaum Interesse haben, ihr Dasein in Frage zu stellen. Wie die Made im Speck! Ein durchaus passendes Gleichnis. Warum soll die Made den Speck verlassen, wenn dieser Ausflug nur mit Nachteilen verbunden ist. Eine neue Futterquelle zu suchen, bedeutet Herausforderung, vielleicht sogar Entbehrung und bringt Unsicherheit. Selbst eine Made ist nicht blöd.
Aber hinterfragt man dieses Gleichnis, dann bin ich mir nicht so sicher, ob ihr weiterhin so eine verwöhnte Made sein möchtet. Eine Made ist eine wurmförmige Insektenlarve, die mit Vorliebe in verfaulenden Lebensmitteln vegetiert und dient seit Hunderten von Jahren als Sinnbild des Todes und der Verwesung. Diese faule Made lebt im Überfluss und von toter Materie. Im Grunde genommen kein appetitliches Bild und über den damit verbundenen Gestank schweigen wir geflissentlich, trotzdem gefällt mir dieses Gleichnis im Zusammenhang mit unserer Gesellschaft.
Da ächzt es an allen Ecken und Enden – ich will mich jetzt gar nicht auf einzelne heiße Themen einschießen – und was passiert? Die Mehrheit unserer Mitbürger fühlt sich nicht betroffen und schon gar nicht verantwortlich. Nur nicht den Speck verlassen. Man streckt nicht einmal den Kopf aus dem ranzigen Fett, man ignoriert das Problem und wenn es hochkommt, dann redet man sein Verhalten schön. Ein lustiger Reflex. Wer sucht, der findet immer Gründe, die zur Rechtfertigung taugen.
Wer macht das nicht? Hand aufs Herz, sucht ihr nicht auch manchmal nach faulen Ausreden, wenn euer Lebensmodell plötzlich Schwachstellen bekommt wie altes Bindegewebe. All diese moralischen, gesellschaftlichen und umweltbelastenden Scherereien kann man als Einzelner nicht lösen und ihr argumentiert, dass man nicht für jede Misere auf dieser Welt verantwortlich gemacht werden kann. Ja, das hat was, da kommt doch der Speck gelegen. Man kann nie genug davon haben.
Ich mach jetzt Schluss, es ist Zeit für das Nachtessen. Es riecht verführerisch nach Dörrbohnen, Salzkartoffeln mit Rippchen und Speck.
©Krumm, Daniel
März 2020
DÜNKEL
Dieser Begriff erschien diese Woche überraschend wieder einmal auf meinem Radar. Lange ist es her, als ich ihn zum letzten Mal zu lesen bekam, dass er mir beinahe etwas veraltet vorkommt. Er scheint, wie aus der Zeit gefallen, ein Relikt. So redet man heute eher von Arroganz, wenn die elitäre Gesellschaft auf die unteren Schichten der Bevölkerung hinabblickt. Der verachtende Blick von oben nach unten, meist von einem blasierten Lächeln begleitet. Der Begriff Dünkel ist viele Jahrhunderte alt, entstanden im Zeitalter der klaren Standesunterschiede, als man wusste, wo man hingehörte. Dünkel oben, Demut unten. Das war noch eine einfach strukturierte Welt.
Das Foto zeigt das goldene Tor von Schloss Versailles, welches unter Ludwig XIV, dem Sonnenkönig, zu seinem opulenten Glanz kam. Dieser Sonnenkönig war mit Sicherheit der König des Dünkels. Völlig abgehoben, selbstherrlich und ohne spezielles Interesse am Volk. Er und seine Nachfolger überspannten den Bogen derart, dass es dann am Ende des achtzehnten Jahrhundert zur Französischen Revolution kam. Selbst schuld.
Glücklicherweise gibt es in einer modernen Gesellschaft keine adligen Despoten mehr und man begegnet sich auf Augenhöhe. Äh, wenn ich es mir allerdings genau überlege, dann stimmt das nicht so ganz. Der Dünkel erinnert mich an die Rolling Stones: nicht totzukriegen. Da gibt es zum Beispiel die Gutmenschen, welche auf die Schlechtmenschen herunterschauen. Jeder, der sich für wertvoller hält, straft einen minderwertigen Menschen mit verachtenden Blicken von weit oben herab. Die Spannungsfelder der Dünkel sind übrigens zahlreicher, als man denkt. Da blickt der Veganer auf den Fleischesser, der Fahrradfahrer auf den SUV-Fahrer, Rechts auf Links, der Klassik-Liebhaber auf den Helene-Fischer-Fan, der Umweltaktivist auf den Vielflieger, der Akademiker auf den Arbeiter, der Digitale auf den Analogen hinunter und umgekehrt. Diese Liste ist nicht abschließend. Man könnte den Eindruck erhalten, der Dünkel hat sich seuchenartig verbreitet, wurde quasi zu einem Allgemeingut. Alle können vor sich hin dünkeln und auf die Anschauung der Anderen pfeifen. Und darüber hinaus ist es symptomatisch, dass man sich gegenseitig nicht zuhört. Jeder ist von der Richtigkeit seiner Meinung überzeugt, was interessiert mich da die Haltung Andersdenkenden.
Selbst ich habe recht mit diesen Zeilen. Alles Ignoranten, die nicht meiner Meinung sind. Mit Verachtung werde ich auf jene hinunterblicken.
©Krumm, Daniel
Januar 2020
FEUERWERK
Ich habe keine Freude an einem Feuerwerk!
Ihr werdet mich jetzt sogleich dem Lager der Öko-Moralisten oder jenem der Tierfundamentalisten zuteilen, die sich im Vorfeld des Jahreswechsels für das Verbot der sinnlosen Knallerei stark gemacht haben. Selten hat dieses Thema so viel Emotionen freigelegt wie auf der Zielgeraden des vergangenen Jahres und trotzdem wurden noch nie so viele Raketen in die Luft gelassen. Einzig Nordkoreas Rumpelstilzchen Kim Jong-un kann da mithalten.
Ökologie und Tierschutz wären Anlass genug, aber ich rede hier von zwei anderen Gründen, die mich pyromanische Darbietungen in einem kritischen Licht sehen lassen:
1. Mich langweilt ein Feuerwerk!
Wann ich das letzte Mal bewusst an ein Feuerwerk angeschaut habe, kann ich mich nicht mehr genau erinnern. Vielleicht fünfundzwanzig, vielleicht auch dreissig Jahre muss das her sein, aber der Eindruck, der mir blieb, ist mir heute noch präsent. Nachdem die ersten Raketen explodierten, folgte nur die Wiederholung des Beginns in farblichen Variationen und in verschiedener Intensität und am Schluss ein Bouquet mit einigen fetten Bomben. Schon damals wurde mir klar, diese zwanzig Minuten könnte man komprimieren oder weit lustiger: Aufgrund eines Kurzschlusses in der Feuerwerkssteuerung geht alles gleichzeitig hoch. Ha, das wäre ein Spektakel. Man bekäme keine kalten Füße und keine Genickstarre. Ich hatte das Gefühl an einem schlechten Fußballspiel gewesen zu sein. Viel langweiliges Ballgeschiebe, manchmal ein wenig Kampf und Krampf, schlussendlich ein torloses Unentschieden. Der Zuschauer fragte sich: War‘s das? Er schaute noch eine Weile nach oben, aber da hatte es nur weiße Wölkchen am schwarzen Firmament. Dann wackelten sie nach Hause.
2. Ein Feuerwerk macht mich nicht glücklich!
Ein emotionaler Krüppel, den funkelnde Blumen in der Nacht und glitzernder Baldachin am Himmelsgewölbe nicht glücklich machen. Die Ästhetik wäre Grund genug, daran Freude zu haben. Dabei ist die Vergänglichkeit des Schönen etwas durchaus Reizendes und Symbolhaftes, das gebe ich zu, aber ein Feuerwerk hat nicht mehr Gehalt als ein Glas Wein auf nüchternen Magen. Ein leichtes Räuschchen mit schlechtem Geschmack im Mund. Piff-Paff-Puff und am Schluss die große Sauerei. So etwa und mehr nicht. Das Ganze erinnert stark an die unsäglichen Unterhaltungssendungen im Fernsehen. Man schaut es sich halt an, weil äh ... weil, na ja, weil halt jeder so seine Gründe hat. Aber glücklich macht es kaum jemanden.
In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wünsche ich euch ein beschwingtes Jahr ohne schlechten Geschmack im Mund.
©Krumm, Daniel
Januar 2020
François-Xavier Fabre, 1814, 'La Mort de Narcisse' (Der Tod von Narziss)
RECHTFERTIGUNG
Liebe Freunde, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, im Zeitalter der Rechtfertigung zu leben?
Man muss sich rechtfertigen, wieso man ein fettes Auto fährt, wieso man dauernd auf Facebook ist, wieso man raucht und säuft, wieso man sich trashige Fernsehsendungen ansieht, wieso man auf Malle Urlaub bucht, wieso man Fleisch isst, wieso man zu dick ist, wieso man kein Buch liest, wieso man keine lauten Kinder mag, wieso man für alles zu bequem ist, wieso man sich Pornofilme anschaut, wieso man an nichts Interesse hat und wieso man überhaupt alles scheiße findet.
Egal, was man macht, man muss sich dafür rechtfertigen, denn irgendwie ist alles dämlich, unmoralisch oder schädigend, je nach dem, aus welcher Warte man es betrachtet. Dauernd werden wir mit unseren Unzulänglichkeiten konfrontiert, was in der Regel ein mieses Gewissen zur Folge hätte, gäbe es da nicht Ausreden ... äh, Pardon ... Rechtfertigungen, die man sich zurechtgelegt hat.
Man kann alles schönreden, idealistische Fehltritte, verbale Entgleisungen und fragwürdige Lebenseinstellungen. Man ist sich selbst ja am nächsten. Egal, ich wage nicht, den ersten Stein zu werfen, bevor ich mich nicht selbst gerechtfertigt habe. Jetzt könnte ich ja eine meiner irrelevantesten Schwächen legitimieren, um, reingewaschen von Defiziten und Sünden, weiter über die Unzulänglichkeiten anderer herzuziehen.
Davon sehe ich ab, denn ich werde einer meiner widerlichsten Mängel rechtfertigen: Eitelkeit!
Ja, ich bin eitel. Dabei geht es gar nicht nur um den äußeren Schein, bei weitem nicht, es geht um Anerkennung, wenn nicht sogar Bewunderung, und letztlich um Erfolg. Dieser Wesenszug ist mir in Wirklichkeit peinlich und trotzdem fühle ich mich gekränkt, gäbe es auf mein Sein und Schaffen keine positive Resonanz. Wenn diese Kolumne auf Facebook kein einziges Mal gelikt würde, bekäme meine Eitelkeit einen üblen Kratzer.
Wie lässt sich nun so ein selbstgefälliges Gebaren rechtfertigen? Im Grunde genommen gar nicht. In der katholischen Theologie gilt die Eitelkeit als eine der Hauptsünden und der Narzissmus als deren Steigerung. Ich bewege mich also nicht auf dünnem Eis, sondern auf vermintem Gebiet. Ein falscher Schritt und ich werde in der Luft zerrissen. Wer mag schon selbstüberzeugte Typen. Jetzt meine Rechtfertigung: Ich bin gar nicht so, wie ihr denkt. Ich will es ja nur allen recht machen, in erster Linie mir selbst, denn ich bin ein Perfektionist. Glaubt mir, das ist nicht lustig.
Da fragt mich doch soeben meine Frau: Sind Rechtfertigungen nicht so etwas wie ein Schuldeingeständnis?
©Krumm, Daniel
Dezember 2019
RECHTFERTIGUNG
Liebe Freunde, habt ihr nicht auch manchmal das Gefühl, im Zeitalter der Rechtfertigung zu leben?
Man muss sich rechtfertigen, wieso man ein fettes Auto fährt, wieso man dauernd auf Facebook ist, wieso man raucht und säuft, wieso man sich trashige Fernsehsendungen ansieht, wieso man auf Malle Urlaub bucht, wieso man Fleisch isst, wieso man zu dick ist, wieso man kein Buch liest, wieso man keine lauten Kinder mag, wieso man für alles zu bequem ist, wieso man sich Pornofilme anschaut, wieso man an nichts Interesse hat und wieso man überhaupt alles scheiße findet.
Egal, was man macht, man muss sich dafür rechtfertigen, denn irgendwie ist alles dämlich, unmoralisch oder schädigend, je nach dem, aus welcher Warte man es betrachtet. Dauernd werden wir mit unseren Unzulänglichkeiten konfrontiert, was in der Regel ein mieses Gewissen zur Folge hätte, gäbe es da nicht Ausreden ... äh, Pardon ... Rechtfertigungen, die man sich zurechtgelegt hat.
Man kann alles schönreden, idealistische Fehltritte, verbale Entgleisungen und fragwürdige Lebenseinstellungen. Man ist sich selbst ja am nächsten. Egal, ich wage nicht, den ersten Stein zu werfen, bevor ich mich nicht selbst gerechtfertigt habe. Jetzt könnte ich ja eine meiner irrelevantesten Schwächen legitimieren, um, reingewaschen von Defiziten und Sünden, weiter über die Unzulänglichkeiten anderer herzuziehen.
Davon sehe ich ab, denn ich werde einer meiner widerlichsten Mängel rechtfertigen: Eitelkeit!
Ja, ich bin eitel. Dabei geht es gar nicht nur um den äußeren Schein, bei weitem nicht, es geht um Anerkennung, wenn nicht sogar Bewunderung, und letztlich um Erfolg. Dieser Wesenszug ist mir in Wirklichkeit peinlich und trotzdem fühle ich mich gekränkt, gäbe es auf mein Sein und Schaffen keine positive Resonanz. Wenn diese Kolumne auf Facebook kein einziges Mal gelikt würde, bekäme meine Eitelkeit einen üblen Kratzer.
Wie lässt sich nun so ein selbstgefälliges Gebaren rechtfertigen? Im Grunde genommen gar nicht. In der katholischen Theologie gilt die Eitelkeit als eine der Hauptsünden und der Narzissmus als deren Steigerung. Ich bewege mich also nicht auf dünnem Eis, sondern auf vermintem Gebiet. Ein falscher Schritt und ich werde in der Luft zerrissen. Wer mag schon selbstüberzeugte Typen. Jetzt meine Rechtfertigung: Ich bin gar nicht so, wie ihr denkt. Ich will es ja nur allen recht machen, in erster Linie mir selbst, denn ich bin ein Perfektionist. Glaubt mir, das ist nicht lustig.
Da fragt mich doch soeben meine Frau: Sind Rechtfertigungen nicht so etwas wie ein Schuldeingeständnis?
©Krumm, Daniel
Dezember 2019
BLACK FRIDAY
Demnächst in diesem Theater: Black Friday!
Höre ich Black Friday, dann kommt mir unweigerlich Bloody Sunday in den Sinn. Keine lustige Assoziation, denn 1972, an einem Sonntag, erschossen britische Soldaten im Londonderry vierzehn katholische Demonstranten, der Nordirlandkonflikt eskalierte danach völlig. Die Aufarbeitung dieser fürchterlichen Geschichte beschäftigt England und Nordirland noch heute. Ich bin ein grosser Freund Irlands, war in den Siebzigerjahren dort und bekam hautnah mit, was dieser Konflikt diesem gebeutelten Volk angetan hat. Ein Drama, ein jahrhundertealter Krieg der Völker und deren Konfessionen mit sinnlos vielen Opfern.
Ihr werdet jetzt anmerken, dass dieser Bloody Sunday nichts, aber rein gar nichts mit dem Black Friday zu tun hat, außer einer ähnlichen Terminologie. Vordergründig stimmt das durchaus, und trotzdem möchte ich einen Bogen spannen, obwohl dies als eine geschmacks- und pietätlose Entgleisung wahrgenommen werden könnte. Ich befürchte, eines Tages wird aus einem Black Friday ein Bloody Sunday. Ja, ich frage mich, wie lange es dauert, bis sich aus einem Konsumspektakel ein wirtschaftliches Desaster entwickelt. Dabei ist dieser Black Friday nur die Spitze des Eisbergs. Der Online-Handel und ein ausufernder Konsumwahn lassen solche Aktionstage zu einem ökonomischen Desaster werden. Ein spektakuläres Harakiri des Handels. Riesige Umsätze und kein Gewinn. Der Händler, der daran nicht teilnimmt, hat so oder so verloren, also sagt er sich, lieber Umsatz und kein Gewinn, als kein Umsatz, kein Gewinn und erst noch keine Kunden mehr. Jeder, der in der Schule rechnen gelernt hat und eine Milchbüchlein-Rechnung auf die Reihe bekommt, weiß, dass solch ein Kampf nur die Großen, Mächtigen und Starken überleben. Viele bleiben auf der Strecke, Firmen bluten aus, womöglich sogar jene bei der du arbeitest. Zu Beginn sind es Einzelschicksale und die Faust bleibt im Sack. Bis es der Wirtschaft und dem Bürger an das Eingemachte geht, dann stehen plötzlich die Gilets jaunes auf der Straße, zücken die Fäuste und zünden Barrikaden an. Sicher ist, es verschwinden Arbeitsplätze und das soziale Gleichgewicht kommt immer mehr in Schieflage. Und in diesem Moment wird die Wut geboren, die bereits die Iren gegen die Engländer aufwiegelte. Nicht aus kulturellen, territorialen, konfessionellen und sozialen Gründen lehnt sich der Ohnmächtige gegen den Mächtigen auf, es ist das nackte Überleben, was ihn zur Revolte treibt. Und irgendwo und irgendwann wird es dann sinnlose Opfer geben, und dies nur, weil wir den billigsten Weg zum Besitz gesucht haben. Die Konsumspirale ins Verderben oder reißerisch angepriesen:
Einmaliges Angebot! – greifen Sie zu! – zum Spottpreis in die Misere ...
Ein drastisches Szenario! Glücklicherweise ein Fantasiegebilde, dem es an jeglicher Grundlage mangelt. Eine pessimistische Schwarzmalerei.
Bloody Friday!
©Krumm, Daniel
November 2019
VERNETZUNG
Sich zu vernetzen, ist das Credo unserer Zeit.
Das wurde mir bei der Lektüre eines namhaften Sonntagspresseorgans so richtig bewusst, denn da wurde von den ungeahnten Vernetzungsmöglichkeiten von E-Bikes berichtet. Kaum wird etwas elektrifiziert, installiert man einen Chip und schon ist dieses Teil mit der Welt vernetzt. Dank der Vernetzung werden Gefahren im Verkehr erkannt und dem E-Bike-Fahrer gemeldet, Leistungsdaten des Fahrers lassen sich auswerten und sportlich ambitionierte Elektro-Radfahrer, sofern es solche gibt, können sich in der Cloud messen, ohne sich direkt ein Rennen zu liefern.
Eine feine Sache, entlastet es doch das aktive Denken des Menschen und schafft Platz für Neues, neben der körperlichen Anstrengung wird nun auch das Denken abgenommen. Entschuldigt, das war nicht nett, aber dieser Zynismus ist nur ein Zeichen meiner Irritation. Im selben Artikel wurde nämlich über weitere Vernetzungsoptionen geschrieben, zum Beispiel über die Möglichkeit, das Fahrrad mit dem Kühlschrank zu verbinden, damit der auf dem Weg zum Supermarkt, den aktuellen Bedarf mit passenden Rezepten übermittelt. Ich bin begeistert! Da teilt mir mein Fahrrad mit, dass mein letztes Joghurt seit vier Tagen abgelaufen ist, mir für ein Teller Spaghetti die Spaghetti fehlen und ich aufgrund der Körpermesswerte keinen Wein kaufen sollte. Der vertieften Vernetzung sind null Grenzen gesetzt. Das Fahrrad, dein Freund und Helfer. Das Fahrrad transportiert dich nicht nur, es ist empathisch, sorgt sich um dich, unterhält dich, tröstet dich, führt dich, verführt dich und wenn du Pech hast, tötet es dich.
Das E-Bike dein Schicksal! Aber ist es sinnvoll, sich mit seinem Schicksal zu vernetzen? Wieso nicht? Wir Menschen haben es immer verstanden, uns verführen zu lassen, sogar vom Teufel persönlich, wenn erforderlich. Einverstanden, jetzt trage ich etwas dick auf, aber ich bin nicht fähig das Thema E-Bike neutral und emotionslos zu betrachten. Täglich werde ich mehrfach Zeuge, was so ein Elektro-Fahrrad aus einem unbescholtenen und friedlichen Menschen macht. Da werden Sanftmütige zu Zombies, Rechtschaffene zu Guerillas, Gemütliche zu Rambos, Tolerante zu Egoisten und Lebensfrohe zu Lebensmüden. Faszinierend, was solch ein Gerät für einen Einfluss hat und dies noch unvernetzt. Man stelle sich vor, was erst mit dem E-Bike-Fahrer passiert, wenn sein Gefährt vernetzt ist. Da entsteht eine neue Spezies, ein Cyborg auf zwei Rädern, geleitet und hofiert von einem Chip, durchdrungen von unendlich vielen Informationen. Die logische Evolution führt zur Verschmelzung des E-Bike-Fahrers mit dem E-Bike, die Fusion von Mensch und Maschine zu einer Einheit, quasi zum Terminator der Straße.
An dieser Stelle erwachte ich schweißgebadet mit heftig pochendem Herz.
©Krumm, Daniel
Oktober 2019
KAMPAGNE
Genuss ist an und für sich keine Sünde, so fern sie nicht in Völlerei endet, ja zeugt sogar von grossem Respekt vor dem Nahrungsmittel und von sinnenhafter Freude an feinem und gesundem Essen. Auch Kunst, eine prächtige Aussicht, ein heisses Bad, prickelnder Sex, der wärmende Sonnenschein, ein geselliger Abend oder ein spannendes Fußballspiel sind Genuss, wenn man dies zu würdigen weiß. Wenn man dies nicht zu würdigen weiß, dann verkommt das Essen zur Nahrungsaufnahme, Kunst zur Dekoration, eine prächtige Aussicht zur öden Landschaft, ein heisses Bad zur Zeitverschwendung, prickelnder Sex zur rhythmischen Leibesübung, der wärmende Sonnenschein zur Klage über die Hitze, der gesellige Abend zur Langeweile und das spannende Fußballspiel zur seichten Unterhaltung.
Obwohl die angepriesene Genusswoche längst der Vergangenheit angehört, stehen in der Stadt weiterhin diese Plakate herum, was mich grundsätzlich nicht stört, aber trotzdem zu denken gibt. Es ist weniger die mangelnde Aktualität, die nervt, es ist die gutgemeinte Aussage, die mir leicht auf den Senkel geht. Eine mit Steuergeldern geförderte Kampagne will mir den Genuss näher bringen und den Nichtgenießern weismachen, dass sie auf dem Holzweg wandeln. Bezüglich der Genusswoche stellt sich die Frage, ob durch diese Kampagne einem überzeugten Junkfood-Vertilger plötzlich die exotische Welt der Gewürze, die verführerischen Düfte der Kräuter, der Geschmack von frischem Gemüse oder die Qualität sorgfältig und fair produzierter Lebensmittel näher gebracht werden kann. Die Genusswoche, ein missionarischer Kreuzzug gegen Convenience und Fastfood. Der Konsument, das hilflose Opfer der hinterhältigen Nahrungsindustrie.
Und darin spiegelt sich die Fragwürdigkeit jeder Kampagne, dabei ist diese nicht mal die Schlechteste. Entweder tritt sie offene Türen ein oder prallt an den geschlossenen ab. Gibt es tatsächlich Leute, die der Überzeugung sind, mit Plakataktionen und anderen Aktionen aus einem Saulus einen Paulus zu formen? Meist ist es die öffentliche Hand, die versucht, uns mit missionarischem Eifer zu besseren Menschen zu bilden. Da empfiehlt man uns das richtige Verhalten in fremden Betten, den Anstand auf dem Elektrofahrrad, den gesunden Umgang mit dem eigenen Körper, die einzig wahre Erziehung der Kinder oder die richtige Entsorgung von Abfall. Lauter Angelegenheiten, bei denen wir Bürger auf fremde Hilfe angewiesen sind, ansonsten die akute Gefahr bestünde, vollkommen zu versagen. Der Staat als Freund ... äh ... Vormund?
Kampagnen sind zahnlose Tiger wie Empfehlungen. Kampagnen überzeugen selten, dafür hinterlassen sie einen moralinsauren Nachgeschmack. Irgendwie kommt mir ja die ganze Sache sehr vertraut vor. Meinen Enkeln zu empfehlen, schön aufzuessen, es ansonsten keine Süßigkeiten gibt, ist genauso kraftlos, da sie genau wissen, dass sie so oder so Süßigkeiten bekommen.
©Krumm, Daniel
Oktober 2019
HÄSSLICHKEIT
Seid ihr nicht auch der Meinung, dass der Hässlichkeit zu wenig Wohlwollen entgegengebracht wird. Immer muss alles ästhetisch, lieblich, romantisch, wohlproportioniert und herzig sein. Niemand zeigt Fotos von hässlichen Sonnenuntergängen und grässlichen Katzenbabys, logisch, das wäre ja ein Widerspruch in sich. Wäre aber witzig, denn solche Absurditäten bergen ein ungeheures Potential in sich. Dankbar liessen sich pseudophilosophische, moralinsaure und zynische Entgleisungen auf diesem Paradoxon aufbauen. Aber eben, niemand hat Freude an Hässlichkeit, und wenn sie dennoch existiert, dann wird sie stillschweigend schöngeredet.
Aber glaubt mir, meine lieben Freunde, sie existiert! In erstaunlicher Vielfalt durchdringt sie unsere Welt, schleicht sich unerkannt in unser Leben, vergiftet unser Urteilsvermögen, bis wir sie kaum mehr erkennen. Das Hässliche unterwandert die Gesellschaft, wie die dunkle Seite der Macht die edle Gemeinschaft der Jedi-Ritter, wie Dieter Bohlen den guten Geschmack, wie die Krankenkassen unser Einkommen, wie die Resistenz die Antibiotika, wie Fake die News oder wie Elektrofahrradfahrer die Verkehrsregeln. Gemächlich und unerbittlich, bis wir uns daran gewöhnt haben.
Berechtigterweise werdet ihr jetzt einwenden, dass sich meine bisherigen Ausführungen zu diesem Thema mit oberflächlicher Belanglosigkeit auszeichnen und ich nicht den Mut habe, das Hässliche konkret zu benennen. Ihr wartet jetzt auf eine repräsentative Auflistung der scheußlichsten Hässlichkeiten, aber da könnt ihr lange warten. Ich werde mich hüten, Trumps Frisur, Helene Fischers Musik, Kim Kardashians Hintern, Thomas Hirschhorns Kunst, Nordkoreas Architektur als anschauliche Beispiele zu benennen, ich könnte mir ja Feinde machen. Allerdings gibt es in Basel seit einigen Monaten ein markantes Gebäude berühmter Architekten, welches immer wieder als Ausbund von Hässlichkeit tituliert wird und einen durchaus lebendigen Disput ausgelöst hat.
Aber ist dieses Gebäude nun hässlich oder nicht? Ja, vielleicht könnte man es als hässlich bezeichnen, wenn man ein Chalet als Maßstab für architektonische Schönheit heranzieht. Blöder Vergleich, ich weiß, aber er zeigt nur auf, wie unsinnig die Definition Hässlichkeit ist. Es gibt Leute, und da gehöre ich dazu, die schätzen solch eine ästhetische Provokation. Dieses Gebäude wirkt zwar eigenwillig, technokratisch, manchmal sogar abweisend, aber es hat ein Gesicht, ein Charakter und eine Lebendigkeit, lauter Eigenschaften, die im Einheitsbrei des Städtebaus verloren gehen. Ist die vermeintliche Hässlichkeit also nichts anderes als die Abwesenheit von übertriebener Schönheit oder eine alternative Form der Ästhetik? Alles subjektive Maßstäbe. Letztendlich ist Unkraut auch nur Kraut, weil wir einen Unterschied definieren, den es eigentlich gar nicht gibt.
Ich merke, ich drehe mich im Kreis und verheddere mich in Widersprüche. Aber was sind denn Trumps Frisur, Helene Fischers Musik, Kim Kardashians Hintern, Thomas Hirschhorns Kunst und Nordkoreas Architektur? Vermutlich reden wir hier nicht von Hässlichkeit, sondern über eine Frage des Geschmacks.
©Krumm, Daniel
September 2019
ENERGIE
Der morgendliche Blick aus dem Fenster der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit.
Diesem Sonnenaufgang eine romantische Schönheit abzugewinnen, fällt schwer und zeugt im besten Fall von einer technokratischen Verblendung. Es dümpelt kein Fischerboot im seichten Wasser am weißen, mit Palmen gesäumten Strand, nein, da hat es eine Autobahn, eine Hochspannungsleitung, eine Bahnlinie, eine dichte Besiedlung und im Hintergrund ist die Dampfwolke des Kernkraftkraftwerkes Leibstadt zu erkennen. Da hilft auch keine Sonne, die in einem warmen Orange am Horizont auftaucht und die blaue Stunde zum Tage verfärbt, mit dieser Skyline lässt sich definitiv keine zauberhafte Südseeromantik herbeireden. Eine völlig verstellte Landschaft, mitteleuropäische Zivilisationsdichte, fernab jeglicher Ästhetik und Wohnlichkeit.
Aber dies wollte ich mit diesen Zeilen nur bedingt ansprechen. Bei der Betrachtung des Fotos fiel mir nämlich auf, wie Energie die Szene dominiert. Alles, inklusive der Sonne, haben etwas mit Energie zu tun. Quelle, Produktion, Versorgung und Verbrauch. Alles ist auf diesem Bild präsent. Eine Landschaft im Schatten der Energie. Allerdings, wird mir bewusst, sieht es einige Kilometer weiter nicht viel besser aus. Man muss schon in weit abgelegene Alptäler flüchten, um keinerlei Spuren von Energie zu sichten, abgesehen der Sonne logischerweise. Wie Akne in einem entzückenden Gesicht, wie entzündete Narben auf junger Haut, wie die Spange vor weißen Zähnen, wie Geschwüre am Körper entstellen die Strukturen der Energie das Angesicht der Welt. Als notwendiges Übel könnte man dies bezeichnen oder als Preis für unseren Wohlstand, ja, als eine unumstößliche Grundbedingung, wolle man nicht in die Steinzeit zurückfallen. Eine in Stein gemeißelte Notwendigkeit.
Aber jetzt ein bisschen Sciencefiction! Es gibt doch in der Tat Prognosen für das Jahr 2040, die gehen von einer eidgenössischen Bevölkerung von 10 Millionen Einwohnern aus, also plus etwa 17 Prozent! Ich kratze an meinem Hinterkopf und frage mich: Äääh, wo stapeln wir die alle hin? Eine blöde Frage, die ich jetzt mal im Raum stehen lasse, und kehre zurück zum Foto. Wird der Hunger nach Energie noch markantere Spuren hinterlassen, werden sich Dutzende Windräder, zusätzliche Hochspannungsleitungen, Hochhäuser und weitere Autobahnspuren dazugesellen? Und, Achtung, jetzt kommt eine wahnsinnig dramatische Frage: Wird dann die Sonne weiterhin für alle aufgehen?
So hört sich Hysterie an, aber so hören sich auch Fragen an, die man sich getrost stellen darf. Sich die Finger in die Ohren zu stecken und laut schreien, ist genauso keine Lösung. Allerdings habe ich nicht eine einzige vernünftige Antwort, höchstens einige unausgegorene Ideen, aber etwas beruhigt mich trotzdem: Mich könnte man getrost in die Landschaft stellen, ich bin morgens sowas von energielos, mein Anblick würde die Umwelt wenigstens nicht belasten.
©Krumm, Daniel
August 2019
HALBWISSEN
Ein Storch mitten in der Stadt auf einem Bürogebäude. Ein ungewohnter, wenn nicht sogar ein befremdender Anblick. Hat er die Orientierung verloren? Wo findet er hier seine Nahrung? Ja, so etwa wäre die Reaktion auf diese Szene, wüsste man nicht, dass sich im Rücken des Fotografen der Zoo mit seinen unzähligen Storchennestern befindet. Weil ihr nur die Hälfte wisst, bleibt euch die Sicht auf das Ganze verwehrt.
Mir wurde erst kürzlich gewahr, dass sich mein Wissen in erster Linie aus Halbwissen zusammensetzt. An und für sich nichts Erwähnenswertes, wenn die Öffentlichkeit meine Überlegungen nicht aufgedrängt bekäme. Allerdings muss ich den Begriff Öffentlichkeit relativieren, denn bei meiner überschaubaren Leserschaft ist man geneigt, von einer Halböffentlichkeit zu reden. Lauter halbe Sachen. Jetzt muss ich mich aber in Acht nehmen, um nicht falsch verstanden zu werden, schließlich hat alles mit der Vorsilbe halb ein minderwertiges Renommee. Wie Halbwissen. Aber aufgepasst, das Halbwissen ist direkt verwandt mit der Halbwahrheit. Wenn man sich nicht vorsichtig und kritisch sein Halbwissen aneignet, läuft man Gefahr, Halbwahrheiten zu erzählen. Ihr pflichtet mir sicher bei, zur Halbwissensaneignung ist das Internet prädestiniert, da findet jede Gesinnung eine Wahrheit, die passt. Nehmt mich als Beispiel. Da befällt mich eine Eingebung, nachdem ich per Zufall eine sinnschwangere Situation fotografiert habe und suche Fakten dazu. Woher das Wissen? Keine Frage, Wikipedia oder ähnliche Wissensquellen, dazu gesellen sich hunderte Internetseiten, die Behauptungen in den Raum stellen, die wir für bare Münze nehmen. Ein wahrhaft sumpfiges Gelände!
Halbwissen ist ein 50%-Wissen, bei welchem man davon ausgeht, dass es die richtige Hälfte ist, die man sich angeeignet hat. Es macht ja keinen Sinn, seinen Speicher mit Lappalien vollzustopfen, abgesehen davon, liegt es im Trend, nur noch über ein prägnantes Teilwissen zu verfügen. Das reicht völlig, um Eindruck zu schinden. Fastfood-Wissen, für mehr Tiefe fehlt der Bedarf. Wie die Pendlerzeitung, bei der man nach der Lektüre gleich schlau ist wie vor der Lektüre, da sie weit weniger als Halbwissen anbietet. Nur oberflächliches Viertelwissen.
Einverstanden, man muss nicht alles wissen, ein Halbwissen reicht in den meisten Fällen, aber seit sich Halbwahrheiten wie eine Diarrhöe-Epidemie durch die sozialen Medien verbreiten, wäre eine minimale Skepsis angebracht.
Manchmal lohnt es sich, sich fragend umzudrehen, um sein Halbwissen mit der anderen Hälfte zu ergänzen.
©Krumm, Daniel
August 2019
TURTELTAUBEN
Betrachtet man diese beiden Tauben, dann erklärt sich der Begriff Turteltauben von selbst. Ein perfektes Motiv für Hochzeitskarten, der Auslöser verträumter Seufzer bei Verliebten, ein Sinnbild für harmonische Zweisamkeit. Bei dem Anblick wird diesen Vögeln reflexartig ein menschenähnliches Sozialverhalten angedichtet, und das Verrückte ist, dass das stimmt. Tauben wählen einen Partner und bleiben ihm ein Leben lang treu, erst wenn ein Teil stirbt, sucht sich der andere Teil einen neuen Partner. Sogar bei den Brieftauben funktioniert diese Treue, denn wird ein Teil in der Ferne freigelassen, will jene Taube möglichst schnell zum Partner zurück. Respekt! Davon können wir Menschen eine Scheibe abschneiden, zumindest einige von uns.
Allerdings erhebe ich da vehement Einspruch, denn wären die Tauben Menschen, dann möchte ich ihre moralische Reinheit nicht mehr auf den Prüfstand stellen. Ja, denn derartige Vergleiche hinken, ich behaupte sogar, sie gehen an Krücken. Drehen wir diesen Vergleich um und stellen uns vor, wir wären Tauben und wir sähen alle gleich aus. Keine unterschiedliche Haarfarbe, alle haben dieselbe Figur, identische Kleidung, dasselbe Gesicht. Als Täuberich würde es keinen Unterschied machen, welche Täubin ich wählte. Was verfügbar wäre, würde genommen. Es gäbe den Reiz des Anderes nicht, keine Verführung, nur langweiligen Einheitsbrei. Ihr werdet jetzt argumentieren, dass vermutlich Unterschiede herrschen, die wir Menschen nur nicht wahrnehmen. Möglich, nur habe ich keine Lust, jedes Mal, bevor ich meine Frau küsse, akribisch hinzuschauen, um sicher zu sein, ob sie es ist, und um keine Ohrfeige einzuhandeln. Und dann noch ein weiteres Argument: In der Welt der Tauben existieren keine Laster und keine Verführungen. Man bedenke, was Alkohol oder ein sinnlich zur Schau gestelltes Stück Haut alles in uns auslösen kann. Kein Balsam für die Augen, kein Futter für die Fantasie, kein Treibstoff für die Laune. Nichts davon! Das Erscheinungsbild der Stadttauben erinnert stark an die Strahlkraft nordkoreanischer Uniformen, eintönig und zugeknöpft bis oben. Mit dieser laienhaften Aussage habe ich mir jetzt sämtliche Tauben-Enthusiasten zu Feinden gemacht, völlig nachvollziehbar, denn es gibt neben der angesprochenen Stadttaube etwa 300 weitere Arten, die mit ihrer exotischen Vielfalt und Schönheit zu begeistern wissen.
Aber ich spreche hier von den profanen Stadttauben, schließlich rede ich auch von mir und nicht von Brad Pitt. Ich spreche von der grauen Maus unter den Tauben, also jener, die uns auflauert und versucht, uns zu bescheißen. Mist, ich schweife ab und habe gerade Mühe den roten Faden wieder zu finden. Ach ja, ich wollte euch erklären, dass wir Menschen keine Tauben sind, respektive Tauben die besseren Menschen wären, wenn sie nur mehr Haut zeigten. Oder so.
Ich denke, es ist zu heiß für Arbeit…
©Krumm, Daniel
Juli 2019
BERGWERK
Wart ihr schon mal in einem Bergwerk? Wenn nicht, dann solltet ihr das dringend nachholen, außer ihr leidet unter Klaustrophobie oder ihr wollt partout nicht wissen, wieso man sich Jahrzehnte lang durch einen Berg wühlt. Ich durfte am letzten Wochenende das Bergwerk Finstergrund im Schwarzwald besichtigen und bin überzeugt, auch ihr würdet staunen, auf welche Weise damals Rohstoffe aus dem Untergrund gebrochen wurden, damit unser Leben überhaupt werden konnte, wie es heute ist. Ich rede in Vergangenheit, da die meisten Bergwerke in Europa stillgelegt wurden oder dem Untergang geweiht sind. Zu aufwändig, nicht mehr rentabel, hohe Sicherheitsanforderungen. Nur in Ländern, wo der Mensch und die Natur als Verschleißmaterial gelten, ist der Abbau von Rohstoffen noch konkurrenzfähig. Aber lassen wir das und quetschen uns in die Grubenbahn, die nur unwesentlich größer scheint als eine Modelleisenbahn von Märklin. Dann rumpeln wir in den Stollen, vorbei an der heiligen Barbara, durch roh ausgebrochenen Fels, einige hundert Meter hinein in den Berg. Es ist acht Grad kalt und Wasser tropft von der Decke.
Peter, ein stolzer Bergmann aus Dortmund beginnt mit seinem herrlich schnoddrigen Dialekt zu erzählen. Hier im Schwarzwald wurde hauptsächlich Flussspat und Schwerspat abgebaut, ein Mineral, von dem ich das erste Mal zu hören bekomme. Unter schwierigen Bedingungen, mit einem hohen Anteil an roher Muskelkraft und mit viel vergossenem Blut brach man dieses bläulich schillernde Gestein mühsam aus dem Fels. In der nächsten Ortschaft wurde der Stein gebrochen, sortiert und als Rohstoff weiterverkauft. Und jetzt wird es interessant! Für was braucht man Flussspat und Schwerspat? Wichtig sind sie für die Glas-, Keramik- und Metallverarbeitung, für Zahnpasta, für Farben, für Grundierungen, für Korrosionsschutz, für Bodenbeläge, für Erdöl- oder Erdgasbohrungen, für Schwerbeton, für Füllstoffe, für Schallschutzstoffe, für nicht brennbare Kunststoffe, für Gummiprodukte, für Bremsbeläge und für vieles mehr. Wahnsinn, was wäre das Leben ohne Flussspat und Schwerspat!
Zwischen 1936 und 1974 förderte man im Bergwerk Finstergrund eine Million Tonnen Stein, 50% davon war verwertbarer Rohstoff. Zurückbleibt ein Berg, wie ein Emmentaler Käse, den man kaum mehr begehen kann, ohne einzubrechen und einige Stockwerke tiefer den Ausgang suchen zu müssen. Abbau von Rohstoffen ist ein hartes Geschäft und hinterlässt meist den einen oder anderen Kollateralschaden, in diesem Fall erscheint er direkt homöopathisch.
Als Konsument ist man sich kaum bewusst, was es braucht, damit man irgendein Produkt herstellen kann. Aber da gäbe es eine anschauliche Methode. Stellt euch vor, jeder müsste sich die Rohstoffe, aus dem das Produkt besteht, das er zu kaufen gedenkt, selbst abbauen. Zwei Stunden mit der Spitzhacke auf eine Felswand eindreschen, bis genug Fluor aus dem Flussspat gewonnen werden kann, dass es für eine Tube Zahnpasta reicht. Stellt euch vor, was es zu bedeuten hätte, ihr müsstet auf diese Weise euer nächstes Smartphone erarbeiten. Ein idiotischer Gedanke, das ist mir klar, aber es führe uns vor Augen, was alles an Rohstoffen und an industriellem Aufwand in unserem Alltag steckt. Vielleicht hat man dann etwas mehr Respekt vor dem Produkt und schmeißt es nicht so schnell weg.
©Krumm, Daniel
Juli 2019
IRRTUM
Eines Morgens schaute ich gedankenverloren in den wolkenlosen Sommerhimmel des Languedocs, betrachtete verträumt die weißen Kondensstreifen, welche Flugzeuge ins Blau gemalt hatten, und es dauerte einige Minuten bis mir diese Spur auf dem Foto zu denken gab.
In der Regel zerfurchen Flugzeuge den Luftraum in geraden Linien von A nach B, aber nicht diese. Unweigerlich stellt sich mir die Frage nach dem Warum. Kondensstreifen entstehen in Höhen von über achttausend Meter, also nicht dort, wo Freizeitpiloten umherirren oder Kampfpiloten sich ihre Luftschlachten liefern. Dies ist die Flughöhe, welche in der Regel den großen Jets vorbehalten ist. Gehen wir davon aus, dann erscheint eine solche Schlaufe als befremdend. Was kann der Pilot einer Verkehrsmaschine veranlasst haben, umzukehren?
- „Bist du sicher, dass diese Seite der Karte Norden ist?“
- „Scheiße, ich habe zu Hause den Backofen nicht abgestellt!“
- „Ich hab keine Lust mehr.“
- „Hätten wir nicht Passagiere mitnehmen sollen?“
Bei persönlichen Irrtümern verhält es sich oft ähnlich. Wer gibt schon gerne zu, sich geirrt zu haben. Der Fehler mit dem entstandenen Schaden bevorzugt man in anderen Leuten Schuhe zu schieben, damit man weiterhin mit Fehlerfreiheit glänzen kann. Man? Einverstanden, ich! Wie oft habe ich meine Irrtümer schöngeredet und deren Ursache den Umständen zugeschoben. Übrigens, widrige Umstände sind bestens geeignet, wenn man keinen tauglichen Schuldigen in Griffnähe hat.
Meine lieben Freunde, ich habe nicht vor, meine Irrtümer vor euch auszubreiten, um mich demütig zu rehabilitieren und um möglichst edel zu erscheinen, denn das wollt ihr gar nicht wissen und vermutlich geht es euch auch nichts an. Ich ziehe keine kondensierte Schlaufe in den Himmel, ich bin nicht öffentlich, wofür ich dankbar bin. Es ist schon schwer genug, gegenüber sich selbst einen Irrtum einzugestehen. Na Prost!
©Krumm, Daniel
Juni 2019
ANLEHNUNGSBEDÜRFNIS
Bei einer Wanderung im Languedoc nahm mich dieser Anblick gefangen. Eine Steineiche, die sich an eine Bruchsteinmauer lehnt, als wäre sie müde geworden, dem Mistral zu trotzen. Dieser Wind kann hier im Süden Frankreichs selbst die zähesten Bäume zu Krüppeln formen, vor allem, wenn sie sich mutig auf Kuppen exponieren. Das kann passieren, wenn man sich allzu forsch den Naturgewalten entgegenstellt.
Bewundernswert ist die Lösung, die die beiden gefunden haben. Auch wenn diese Bruchsteinmauer eine mörtellose und brüchige Mauer ist und vornehmlich als Einfriedung dient, hilft sie, so gut sie kann. Zwei Schwache sind zusammen stark. Ich muss zugeben, dass diese Metapher etwas gar plakativ daher kommt, aber sie gefällt mir, denn sie beinhaltet einiges an Wahrheit. Solidarität! Partnerschaft! Aber vielleicht lieben sie sich? Zugegeben, die Liebe zwischen einer Steineiche und einer Bruchsteinmauer erscheint etwas unkonventionell, aber gibt es sowas nicht auch bei uns Menschen. Beziehungen, bei denen man sich fragt: Was hat denn die Zwei zueinander geführt und was hält die zusammen? Meist schweißen doch schwierige Zeiten oder gemeinsame Schicksale zusammen.
Möglicherweise nimmt uns das Streben nach Wohlstand die Illusion von Gemeinschaft, indem wir uns als Individuen in den Vordergrund stellen. Das riecht förmlich nach dem kooperativen Grundsatz des Sozialismus, aber selbst die Vertreter dieser Gesinnung opfern ihre Ideale auf dem Altar des wirtschaftlichen Wachstums, spätestens, wenn sie die Regierungsgewalt in Händen halten. Stop, genug der ideellen Vorwürfen. Alle Anderen sind auch nicht besser, denn grundsätzlich ist der Mensch ein soziales Wesen, aber zuerst kommt immer er selbst.
Zurück zu diesem Baum mit seiner geliebten Mauer. Zwei Individuen, denen man unter Umständen ein Lächeln schenkt, aber deren symbolischer Wert unterschätzt wird. Ein Wink der Natur. Ein Beispiel von selbstloser Kooperation, die ein Leben lang währt, da es keine Alternative gibt. Weder die Steineiche, noch die Bruchsteinmauer können sich davon stehlen, sie sind verwurzelt und platziert an ihrem Ort. Zwei, die sich nicht aus dem Staub machen können, wenn der Wind an ihnen rüttelt und das Leben schwierig gestaltet. Man sucht Lösungen, bespricht Kompromisse, verzeiht Fehler, verspricht sich, zu bessern und rauft sich schlussendlich zusammen.
Die Steineiche motzt wohl des Öfteren über die scharfen Kanten der Steine, während die Bruchsteinmauer sich über den dauernden Druck und die Anstrengung, dagegenzuhalten, beschwert. Der Eine wünschte sich manchmal mehr Distanz und Freiheit, der Andere kann nicht verstehen, weshalb man sich selbst verwirklichen möchte. Alles Argumente, die wir alle schon einmal gehört haben.
Da soll mir doch mal einer weismachen, wir Menschen unterscheiden uns von einer Steineiche und einer Bruchsteinmauer.
©Krumm, Daniel
Juni 2019
RABATT
Wisst ihr, dass viele Bäume vor dem Absterben nochmals besonders reichlich Samen tragen? Ein ultimatives Aufbäumen mit dem Ziel der letztmöglichen Vermehrung und der Erhaltung der Art. Irgendeine biochemische Reaktion, vom kommenden Sterben ausgelöst, investiert die letzte Energie in die Produktion von Samen. Faszinierend. Der Natur muss man nicht sagen, was sie zu tun hat, sie macht ihre Arbeit, auch wenn man ihr das Leben schwer macht. Und wenn sie stirbt, dann stirbt sie, aber erst, wenn sie Plan B angeschoben hat. Hier ziehe ich den Bogen zum Menschen und dessen Detailhandel, aber nicht so, wie ihr das meint, nein, es geht nicht um den Handel mit Früchten, es geht um Rabatt. Meine halbwegs rhetorische Frage lautet: Geben Detailhändler, bevor sie pleitegehen, speziell viel Rabatt?
Ihr werdet antworten: Nicht zwingend! Es kommt darauf an, wie groß deren Ausdauer ist. Das sehe ich auch so, denn da gibt es die Großen und Starken, die mit ihrer aggressiven Preis- und Rabattpolitik so lange auf den Kleinen und Schwachen herum trampeln, bis nur noch ein Trümmerfeld aus Liquidation und Sozialplan übrig bleibt. Nun kommt ihr wieder, da ihr in diesem Fall ein weiteres Naturgesetz zu erkennen meint: Natürliche Auslese! Fressen oder gefressen werden! Einverstanden, Naturgesetze haben eine starke Symbolik und lassen sich auf unendlich viele Lebenssituationen anwenden, aber ich denke, es reicht, wenn wir uns hier auf das Thema Rabatt konzentrieren.
Das Rabattwesen gibt mir zu denken und macht mich misstrauisch. Wie seriös sind diese Rabattschlachten, respektive, wie seriös sind die Bruttopreise? Diese Frage ist schwierig zu beantworten, aber was ich aus eigener Erfahrung behaupten kann, ist die Tatsache, dass wir Menschen auf Rabatt sofort mit erhöhtem Puls, glänzenden Augen und Glücksgefühlen reagieren. Rabatt gehört zu den Botenstoffen der Endorphine. Eine etwas gemeine Nebenwirkung von Rabatt ist die spürbare Reduktion der Urteilsfähigkeit. Hauptsache Rabatt, egal, ob Rabatt drin ist oder nicht, zudem überlegt man nicht, was mit diesem Verhalten ausgelöst wird. Vernichtung der Wertschöpfung, ruinöser Verdrängungswettbewerb, unsoziale Strukturoptimierungen, Verzicht auf Nachhaltigkeit und so weiter und so fort, oder einfach gesagt: Die Zitrone wird ausgepresst, bis nur die leere Schale zurück bleibt.
Ich bin kein Wirtschaftsökonom, darum kommen meine Ausführungen von einem Laien, aber ich behaupte einmal frei aus dem Bauch heraus, dass der Glaubensgrundsatz der Ökonomie ‚Wachstum‘ unsere Wirtschaft irgendeinmal zu einer ausgepressten Zitronenschale werden lässt. Nichts auf der Welt kann unendlich wachsen, ohne anderes zu verdrängen, zu explodieren oder zu implodieren. Ausufernder Rabatt als böses Vorzeichen?
Ja, meine lieben Freunde, ihr lächelt berechtigt über meine allzu simple Sicht auf die Dinge des Lebens. Möglich, dass ich falsch liege, aber ich halte es mit dem Grundsatz von Vivienne Westwood: Buy less, choose well, and make it last! Frei übersetzt: Kaufe weniger, wähle sorgfältig und nutze es lange!
©Krumm, Daniel
Juni 2019
FRÜHLING
Der Mai, der Wonnemonat, jene Zeit im Lenz, welche für Hochzeitsplaner Hochkonjunktur bedeuten und die Triebe bei Mensch und Pflanze sprießen lässt. Erste Blüten zieren den Rasen, um auf der Stelle wieder abgemäht zu werden, schließlich verspürt selbst ein Gartenbesitzer den Frühling und kann kaum erwarten, dem Wildwuchs eine genormte Wuchshöhe zu verpassen. Blumen ja, aber nur dort, wo sie hingehören! Dafür gibt es Ziergehölz, die sich derart protzig mit Blüten dekorieren, dass man befürchtet, die Äste könnten unter deren Last abbrechen. Die Flora gibt sich großzügig, wenn nicht sogar verschwenderisch. Kein Wunder herrscht ein Überangebot an floraler Pracht, dass man vor lauter Blüten die Blumen nicht mehr sieht. Sogar die frische Kleiderkollektion blüht.
So, wie es die Blüten aus den Knospen treibt, flüchten die Menschen aus ihren winterlichen Schlafhöhlen, übervölkern die Straßencafés und reißen die Dächer von ihren Autos, nur um dem Frühling näher zu sein. Parks füllen sich wie japanische Freibäder, Wanderwege verkommen zu Flaniermeilen mit Staugefahr und bleiche Körperteile werden zur Schau gestellt. Nicht alles ist angenehm und ästhetisch, was der Frühling mit sich bringt. Alle wollen die ersten wärmenden Sonnenstrahlen in sich aufsaugen, lechzen nach dem lebenswichtigen Vitamin D und sehnen sich nach einer knackig braunen Haut. Spätestens nach einer Tagesdosis Sonnenschein durch eines dieser Ozonlöcher glüht der Sonnenbrand rot und man jammert über den völlig überrissenen Temperaturanstieg. Es dauert nicht lange, und man ist dem Schönen überdrüssig. Spätestens, wenn der Sommer beginnt, sehnen sich die meisten nach dem Herbst.
Aber seid getrost, der Mai ist nicht mehr das, was er einmal war. Im diesjährigen Mai sorgten Regen, Wind und Kälte für eine homöopathische Angewöhnung an den Frühling, der, wenn es dumm läuft, vom Sommer rechts überholt wird. Der Mai wird niedergeregnet und der Winter geht direkt in den Sommer über. Blütenblätter schwimmen in den Pfützen, Schimmel statt Sonnenbrand. Ich weiß, wir dürfen uns nicht beklagen, denken wir doch an die Natur, die dringend Wasser benötigt, will sie den nächsten Sommer überstehen. Wenn man sich Mühe gibt, dann kann man alles schönreden.
Meine lieben Freunde, ihr pflichtet mir sicher bei, dass der Frühling seinen eigenen Klischees nicht mehr ganz gerecht wird. Früher war das alles besser, da gab es klar gegliederte Jahreszeiten, die zuverlässig ihren Verpflichtungen nachkamen. Da konnte man sorglos den Urlaub buchen und die Würste für das Grillfest bestellen.
Und was will ich euch damit sagen? Ääähhh, eigentlich nichts, aber es sollte uns trotzdem zu denken geben.
©Krumm, Daniel
Mai 2019
OPIUM
Da gab es einmal einen Herrn namens Karl Marx, der behauptete, Religion sei Opium für das Volk. Diese These stellte er vor etwa 200 Jahren auf und vermutlich hätte sie heute einen anderen Wortlaut, da es mittlerweile genügend alternative Lebensinhalte gibt, die mit Opium in Verbindung gebracht werden könnten.
Aber klären wir doch zuerst die Wirkung von Opium. Das Rohopium, gewonnen aus dem Schlafmohn, kann als Opium zur Berauschung oder als Morphium zur Betäubung genutzt werden. Zwei unterschiedliche Wirkungen aus derselben Milch der Kapselfrucht einer wunderschönen und zarten Blume. Somit beenden wir den weiterbildenden Einschub und wenden uns dem eigentlichen Thema zu: Fernsehen.
Ganz im Sinne von Karl Marx behaupte ich: Fernsehen ist Opium für das Volk. Ja, ich denke, es ist möglich, dass Fernsehen berauschend oder betäubend wirkt, je nach Sender und Sendung. Dies ist kaum eine neue Erkenntnis. Keine Angst, ich will mich nicht über den kulturellen Wert einer Suche nach Superstars und Topmodells und auch nicht über die inhaltliche Qualität amerikanischer Serien auslassen, genauso wenig soll meine Meinung über das Fernsehprogramm und die Fernsehwerbung im Generellen ein Thema sein. Ich frage mich nur, warum wir uns das antun. Warum? Ganz einfach, weil wir süchtig sind. Opium macht süchtig. Es macht das Leben so herrlich einfach. Man muss nur konsumieren, man muss nicht denken, darf manchmal einige Emotionen investieren, kann zappen, kann entspannen und dabei sogar einschlafen. Fernsehen gehört mittlerweile zu den zentralen Lebensinhalten, wie Arbeit, Familie, Wohnen und äh…
Ohne diese Flimmerkiste, wäre unser Leben eine Herausforderung, denn wir wüssten kaum, was anzustellen mit dem angebrochenen Abend oder dem verregneten Wochenende. Fernsehen füllt unser Leben, ohne hätten wir ein fürchterliches Vakuum, welches wir nur unter enormen Anstrengungen zu füllen imstande wären. Aber nicht genug. Digitale Anbieter und moderne Streaming-Dienste lassen uns das eigene Programm zusammenstellen, personalisieren den Konsum, abgesehen davon, dass man jetzt immer und überall fernsehen kann, sogar auf dem Smartphone beim Pendeln. Selbst aus einer Toilette heraus war letztlich eine Fußball-Übertragung zu hören. Klassisches Suchtverhalten.
Wir sollten uns fragen, was hinter Marx‘ These steckt, denn er war doch Kommunist, also kein Freund der Religion. Sein Ziel war die klassenlose Gesellschaft und ein geeintes Arbeitervolk. Damit dies zu ertragen war, brauchte das Volk Ablenkung und Trost, da kam die Religion genau richtig. Seither hat sich ganz schön was verändert, obwohl gewisse Rahmenbedingungen gleich geblieben sind. Heutzutage braucht es weiterhin Ablenkung und Trost, nicht nur angesichts der Arbeit. Aber unterdessen verlor die Religion an Kraft, sprich, wurde verdrängt durch das Fernsehen. Darum ist die Politik und die Wirtschaft an einem funktionierenden Fernsehen interessiert, denn nur so lässt sich das Volk bei Laune halten.
Stellt euch mal vor, wie es um unsere Welt bestellt wäre, gäbe es kein Fernsehen. Wir bräuchten dringend Opium!
©Krumm, Daniel
Mai 2019
KITSCH
Meine lieben Freunde, ich muss euch etwas gestehen: Ich habe ein Flair für Kitsch und besitze eine Schneekugel-Sammlung.
Keine Angst, es ist kein Defekt, der Anlass zur Sorge gibt. Es ist auch nicht die Vorstufe zu Rechtsextremismus oder so. Im Gegenteil, Menschen mit einer Neigung zu Kitsch sind harmoniebedürftige Ästheten und sensible Gefühlsmenschen, die sogar über ein gesundes Mass an Leidensfähigkeit verfügen. Ja, ein kitschiger Mensch ist ein gerngesehenes Ziel für den Spott aller Liebhaber des gehobenen Geschmacks, was er mit einem tapferen Lächeln zu ertragen weiß. Hier zeigt sich die Bruchstelle zwischen den beiden Lagern. Einerseits der selbstsichere Hochmut der kunstaffinen Elite, andererseits die zur schamhaften Zurückhaltung neigenden Kitschfreunde. Oft verstecken sie ihre Sammlerexzesse vor der Öffentlichkeit, so wie man abnorme sexuelle Vorlieben nur hinter verschlossenen Türen auslebt oder weil man sich nicht gerne dem Hohn aussetzt.
Ich liebe es, mit Kitsch zu irritieren. Wenn ich stolz die kitschigsten Schneekugeln meiner Sammlung präsentiere, dann wissen selbst Leute, die mich kennen, nicht so genau, ob sie Begeisterung heucheln oder ob sie ihrem Brechreiz Ausdruck geben sollen. Meist ernte ich ein mitleidiges Lächeln. Aber wenn ich dann Kitsch zur hippen Kunstform erkläre, verlieren manche völlig die Contenance. Kitsch sei zweifelhafte Dekoration, aber keinesfalls Kunst, versucht man mich zu überzeugen, als gelte es, mich vor dem geistigen Untergang zu retten. Flugs werden ähnlich gelagerte Kulturformen als Beispiel aufgeführt: Schlager, der Kitsch der Musik; Arztromane, das kitschige Verbrechen an der Literatur; Las Vegas, das architektonische Disneyland; Jeff Koons, der Verkitscher skulpturaler Kunst; Traumschiff, die seicht-triviale Kitschserie; Quentin Tarantino, der Regisseur für verkitschte Kinogewalt und so weiter und so fort. Aber plötzlich entstehen Diskussionen, weil die Grenze zwischen trivialer und ernsthafter Kunst nicht so klar gezogen werden kann. Mit einem Mal wackeln Meinungen und in schundhaft schwülstigen Werken erkennt manch einer die Metapher für die überzeichnete Oberflächlichkeit der Gesellschaft oder die Botschaft, dass sich für jeden Mist einen Abnehmer findet. Kitsch als Reibungsfläche zwischen gutem und gar keinem Geschmack.
Dabei definiert sich Kitsch so simpel. Es stellt nur eine übersteigerte Gefühlswelt mit einer klischeehaften Symbolik dar und klammert alles Tiefgründige, Doppeldeutige, Dogmatische und Anklagende aus. Also alles, was ernsthafte Kunst ausmacht, fehlt bei Kitsch. Einverstanden, nur hat man dabei die Ironie außer Acht gelassen. Kitsch ist doch ein grandioser Tummelplatz für die Ironie, sogar ein Kunstbanause kann sich dessen bedienen, um Verwirrung zu stiften und um bei Kunstkennern als hintergründiger Gesellschaftskritiker zu gelten.
Apropos, ich gedenke, meine Schneekugel-Sammlung zu verkaufen, nur bin ich mir noch nicht im Klaren, ob ich dieses Geschäft über den Kunsthandel oder am Flohmarkt abwickeln will.
©Krumm, Daniel
Mai 2019
LUST
Diese Skulptur gefällt mir, denn sie veranschaulicht auf barocke Weise die Sinnlichkeit der Lust. Manchmal ist es erfrischend, den Begriff LUST im Kontext vergangener Zeiten zu betrachten. So erbaute man um 1736 das feudale Herrschaftshaus im Wenkenpark zu Riehen als Lusthaus und legte angrenzend einen französischen Lustgarten an. Die Skulptur steht in diesem lauschigen Garten und spricht Bände, denn sie zeigt keine zufällige Nacktheit, vielmehr eine verführerische Pose voll knisternder Erotik. Hier muss es wohl hoch zu und her gegangen sein. Welch frivole Zeiten waren das denn, in denen das Liebesleben derart offen ausgelebt wurde. Allerdings war es nur ein Privileg der Reichen, Adligen und Mächtigen, dass man sich in gepflegter Umgebung verlustieren durfte, das kommune Volk musste sich mit Stroh in feuchten Gemäuern zufriedengeben. Es war aber auch ein Zeichen der Dekadenz. Kulturen, welche den Bogen überspannten, zerfielen meist zu Staub, nachdem die herrschende Schicht sich in Lust und Laster verloren hatte. Der französische Sonnenkönig war mit Sicherheit schuld an der Verluderung der Moral zu dieser Zeit. Sein Gebaren musste früher oder später ins Verderben führen, denn nicht nur das einfache Volk, auch die großen Vordenker, wie Rousseau und Montesguieu prangerten die Exzesse der Könige an, dass es schlussendlich zur Revolution kam. Übrigens lief in dieser Epoche ein gewisser Marquis de Sade zur Hochform auf.
Wir sollten aus diesen historischen Entgleisungen unsere Lehren ziehen, damit jegliche Anzeichen von Dekadenz und moralischer Verrohung bereits an der Wurzel bekämpft werden können. Ja, meine lieben Freunde, ich verstehe eure Einwände, dass es bereits zu spät und unsere Moral längst im Eimer sei. Wo herrscht noch Moral? Politik? Wirtschaft? Gesellschaft? Religion? Lassen wir diesen sinnfreien Diskurs und fokussieren uns auf die Lust, welche grundsätzlich immer ein Thema ist, wenn Moral zur Sprache kommt. Und schon wird es schwierig, denn was im 18. Jahrhundert den Leuten die Schamesröte ins Gesicht trieb, löst heutzutage ein Gähnen aus. Seit Fifty Shades of Grey hängt die Peitsche neben dem Staubsauger im Putzkasten und mit Tinder ist der schnelle One-Night-Stand salonfähig geworden. Aber halt, das stimmt nicht flächendeckend, denn da gäbe es ja noch die Doppelmoral. Stop, ich schweife ab, denn wir waren ja bei der Frage stehen geblieben, ob uns die Moral bereits abhandenkam.
Die Beantwortung dieser Frage überlasse ich gerne euch, daran will ich mir nicht die Finger verbrennen, dafür behaupte ich salopp, dass uns vielmehr die Freude an der Lust verloren ging. Irgendwie fehlen uns heute die Leichtigkeit des Spätbarocks und die Erotik des Genusses. Wir sind verkrampft, gehemmt, unter Druck, nicht nur bei der Arbeit, auch im Bett, denn im Netz und in den Medien bekommt man die Schönheits- und Leistungsvorgaben vor Augen geführt. Phantasien gehen verloren, weil wir alles schon gesehen haben. Überdruss macht sich bemerkbar. Was dauernd verfügbar ist, wird reizlos. Erotik wird zum Spiel mit einer Konsole. Wir schauen zu, das ist bequemer.
Womöglich ist der moderne Sex unmoralisch, weil er seine Sinnlichkeit verloren hat.
©Krumm, Daniel
April 2019
PAKETE
Hier stand ich am südlichsten Zipfel Siziliens und spähte in den Dunst des Horizonts, als ich weit in der Ferne diesen Ozeanriesen entdeckte. Er schien kaum vorwärtszukommen, schob sich schwer beladen mit Containern durch das Mittelmeer, vermutlich auf dem Weg nach Genua, Hamburg, Rotterdam oder sonst einem europäischen Hafen. Wisst ihr, dass es über 10'000 solcher Containerschiffe auf den Weltmeeren gibt, die über 80% der weltweit gehandelten Waren transportieren? Unglaubliche Riesen mit einer Länge bis zu 400 Meter und einem Ladevermögen von über 20'000 20-Fuß-Containern.
Was hat dies nun mit dem Titel 'PAKETE' zu tun, fragt ihr euch und ich antworte euch: Sehr viel!
Wisst ihr, dass letztes Jahr 33 Millionen Pakete, sogenannte Kleinwarensendungen, in die Schweiz importiert wurden. Nur in die Schweiz! Davon stammen 23 Millionen Pakete aus dem asiatischen Raum, vor allem aus China. Pro Einwohner sind das 2,7 asiatische Päckchen pro Jahr, ein respektabler Haufen, der während etwa drei Wochen über diverse Meere geschippert wird. Pro Stunde verbraucht so ein Ozeanriese 14‘000 Liter Schweröl, das heißt etwa 28‘000 Liter pro 100 Kilometer und dies ohne Partikelfilter. Eine Fahrt verbraucht 5,6 Millionen Liter Schweröl, der übelste Treibstoff, den es gibt. Selbst wenn eine Tankfüllung 6 Millionen Schweizer Franken kostet, sind das marginale Kosten, wenn man dies auf einen Container runterrechnet. Längst sind die Preise für einen Container von China nach Europa unter 500 Schweizer Franken gefallen, der Transport hat seinen Wert verloren und dies dank der Masse. Eine gewaltige Flut an Paketen, aber auch ein gigantischer Warenstrom aus miesem Plastikspielzeug, billigen Kleidern, minderwertiger Elektronik und gefälschten Markenprodukten. Gewiss gibt es hochwertige Produkte aus Asien, aber von denen reden wir hier nicht, wir sprechen von der Masse.
Da pflügen unzählige Ozeanriesen die Meere um, nur damit Billigware aus neoindustrialisierten Schwellenländern ans andere Ende der Welt gelangt, um durch eine Wohlstandsgesellschaft nach kurzer Gebrauchszeit in Müll verwandelt zu werden. Nüchtern betrachtet, transportiert also ein Großteil dieser Containerschiffe frisch produzierten Müll über 20‘000 Kilometer nach Europa, damit er hier reifen kann, um anschließend entsorgt zu werden. Glücklicherweise entsteht dabei in der Müllverbrennung etwas Heizenergie, so ist nicht alles für die Katz.
Verrückt, was die Masse bewirkt, wenn Produkte billig sind. Oder ist es umgekehrt? Verrückt, was billige Produkte bei der Masse bewirken? Meine ich das nur, oder schalten billige Angebote tatsächlich unser Denken und unsere Vernunft aus? Welche Gründe bewegen jemanden, ein Produkt in China zu bestellen und sich liefern zu lassen? Vermutlich gibt es auf diese Frage nur einleuchtende und nachvollziehbare Begründungen, welche absolut nichts mit dem Preis zu tun haben. Selbstverständlich ist es reiner Zufall, dass gleichzeitig auch der Preis stimmt.
Vielleicht stimmt der Preis nicht mehr, wenn die Transportkosten den Schaden abdecken müssten, welcher beim Transport angerichtet wird. Und denkt daran, mit dem Containerschiff sind die Pakete noch lange nicht am Ziel, dazu braucht es hunderte Lastwagen und Lieferwagen. So, jetzt werdet ihr langsam eure Augen verdrehen und mich endgültig in die grüne Ecke stellen. Ja, meine lieben Freunde, so mag es euch erscheinen, und ich gebe zu, für unseren Planeten gewisse Sympathien zu hegen, aber in erster Linie wünschte ich mir, dass die Masse bei Kaufentscheidungen mehr nachdenken würde.
©Krumm, Daniel
April 2019
RESONANZ
Neulich habe ich in der Sonntagspresse gelesen, dass unser Wesen auf Resonanz ausgelegt ist, um glücklich zu werden. Ich stutze im ersten Moment, als ich dies las, denn die Bedeutung von Resonanz war mir nur in Bezug auf Musik ein Begriff und so verschloss sich mir der Sinn von Resonanz in Relation auf mein Glück. Ein Instrument kommt zum Klingen, wenn der Resonanzkörper zu schwingen beginnt oder ein Lautsprecher hat erst einen Klang, wenn das Gehäuse mitschwingt oder so. Also reden wir hier von komplexer Physik und Schallwellen, und ich bezweifle, dass der Autor des Berichts dies ansprechen wollte. Macht man sich allerdings schlau, dann findet man eine zweite Bedeutung, nämlich: Zustimmung, Anerkennung, Gefallen. - Aha! - Jetzt macht diese Aussage mehr Sinn. Logisch! Wenn ich jemanden liebe, dann macht es mich erst glücklich, wenn jene Person diesem Umstand zustimmt und mich auch liebt. Arbeit macht erst glücklich, wenn der Chef meine Leistung anerkennt und mich lobt. Gefallen den Leuten meine Bücher, macht es mich glücklich. Das Glück, eine Frage der Resonanz.
Was in erster Betrachtung logisch und einleuchtend erscheint, wirft bei zweiter Prüfung einige Fragen auf. Will ich Resonanz, also Zustimmung, Anerkennung und Gefallen, dann muss ich mir Mühe geben, muss ich mich von der besten Seite zeigen, muss ich überdurchschnittliche Leistungen erbringen. Ist es tatsächlich nur möglich, glücklich zu sein, wenn man sein Bestes gibt? Glück als Leistung, Glück als Belohnung, Glück als Ziel, aber nicht als Weg. Ehrlich gesagt, habe ich eine andere Vorstellung von Glück, für mich ist es quasi eine Geisteshaltung. Ich stelle mir vor, dass man kaum glücklich sein kann, wenn man nie zufrieden ist mit dem, was man macht oder hat. Und Streben nach Resonanz nennt man doch Ehrgeiz, was im Umkehrschluss bedeutet, dass Menschen, die nicht ehrgeizig sind, auch nicht glücklich sein können. Ein einfacher Bergbauer, der zufrieden mit sich und der Welt, seine Alp bewirtschaftet und kein Bedürfnis hat dies zu ändern, kann also nicht glücklich sein. Oder vielleicht doch?
Meine lieben Freunde, ich sehe euch schmunzeln, denn ihr spürt den Neid des Besitzlosen zwischen meinen Zeilen. Da plädiere ich für Bescheidenheit, um glücklich zu sein, aber weiß genau, dass auch oberflächliche Materialisten, gierige Kapitalisten, eitle Narzissten, skrupellose Egoisten, pedantische Perfektionisten und über Leichen gehende Karrieristen glücklich sein können. Resonanz kann durchaus glücklich machen. Aber das wäre doch schrecklich unfair, schreit unser Gerechtigkeitsempfinden. Der Spruch ‚Lieber gesund und reich, statt krank und arm!‘ bekommt sogleich einen zynischen Wahrheitsbezug.
Erfolgreich, aber unglücklich! Dieses Credo würden wir gerne hören, dies würde uns glücklich machen. Jawoll!
Mist, Glück scheint eine hochkomplexe Angelegenheit zu sein. Da funktioniere ich weitaus einfacher, mich machen bereits die Resonanzen meiner Lautsprecher glücklich, wenn ich Pink Floyd ‚the dark side of the moon‘ auflege und den Regler auf laut stelle.
©Krumm, Daniel
März 2019
LANGEWEILE
Seziert man diesen Begriff, dann weilt man lange, was bedeutet, dass man längere Zeit verweilt, das heißt, man sitzt rum und bohrt in der Nase. Heutzutage ein nicht akzeptierbarer Zustand, denn damit wird Produktivität und Effizienz von Grund auf ausgeschlossen. Wie soll eine Gesellschaft funktionieren, wenn wir nicht alle mit voller Kraft am selben Strang ziehen. Schande über alle Sozialschmarotzer, die auf Kosten der Allgemeinheit ihr Leben genießen und faul herumhängen. Seid gewarnt, all ihr Nasenbohrer und Müßiggänger, ihr werdet aussterben, wie die Hippies, die mittlerweile das Batik-Leibchen mit dem Businesshemd getauscht und von Marihuana auf Champagner gewechselt haben. Recht geschieht diesen faulen Säcken! Glücklicherweise wird die Langeweile systematisch bekämpft. Dank einer digitalen Durchdringung unserer Existenz können wir jederzeit und überall hochwertige Kommunikation und Unterhaltung konsumieren, eine wichtige Form der Weiterbildung und Sozialisierung einer ansonsten gelangweilten Gesellschaft.
Da gibt es sicherlich einen Widerspruch in unserem System, den man überdenken sollte, ansonsten wir in eine blödsinnige Spirale geraten. Wir werden dauernd effizienter und schneller, das heißt, wir erhalten immer mehr freie Zeit, die wiederum gefüllt werden muss, um Langeweile zu verhindern. Zum Beispiel vermeidet man den Gang in die Stadt zum Einkaufen und bestellt im Online-Handel, womit man ungeheuer viel Zeit gewinnt. Aber was macht man nun mit der gewonnen Zeit, damit ja keine Langeweile entsteht? Ääähhh…? Fernsehgucken? Gamen? Facebook? Spürt ihr diese unsinnige Spirale? Alles wird effizienter, sodass ihr mehr Freizeit habt. Benutzt ihr auch das Self-Checkout im Supermarkt. So seid ihr eventuell fünf Minuten früher zu Hause. Was macht ihr mit diesen fünf Minuten?
Meine lieben Freunde, ihr habt sicher zwischen den Zeilen eine Skepsis durchschimmern sehen. Ja, ich bin tatsächlich kein Sympathisant der digitalen Unterhaltungswelt, denn sie macht uns zum Untertan, zum Süchtigen, zur Marionette. Ich bin sogar weit schlimmer, ich bin überzeugter Verfechter der Langeweile. Ich liebe solche Aussichten wie auf dem Foto, wie gerne würde ich jetzt dort im Gras sitzen und mich eine Stunde lang in diesem Bild verlieren. Klar, spätestens nach zehn Minuten melden sich erste Zweifel, ob die dumpfe Betrachtung einer grünen Landschaft nicht verantwortungslose Zeitverschwendung sei. Keineswegs, kann man entgegnen, nichts ist erholsamer und kreativer als Langeweile. Setzt euch in einen Zug und blickt während der Fahrt nach draußen, lasst euch in einem Straßencafé nieder und beobachtet die Leute, starrt auf einen See und wartet bis ein Fisch springt, nehmt in einer Straßenbahn Platz und versucht nicht in das Smartphone zu stieren oder geht in den Zoo und schaut dem Faultier zu. Man nennt dies Muße, etwas, was wir gerne ein wenig vernachlässigen. Aber ich kann es euch empfehlen, denn in diesem Zustand habe ich meine besten Ideen und wenn mir nichts einfällt, kommt es schon mal vor, dass ich völlig entspannt einschlafe.
©Krumm, Daniel
März 2019
LASTER
Hand aufs Herz, habt ihr nicht auch ein Laster? So eine dunkle Seite, für die man sich ein wenig schämt. Verspürt ihr nicht manchmal einen fiesen Drang, der tief aus einem moralisch verlotterten Gehirnareal in das Bewusstsein dringt und zu einem sündigen Handeln verleitet. Schlummert nicht in uns allen ein unkorrekter Mensch? Wäre ich kriminell geworden, wenn sich meine dunkle Seite durchgesetzt hätte? Klar, manchmal flunkere ich ein wenig, fluche hie und da, kann neidisch und eitel sein, aber ich habe noch niemanden umgebracht. Ich betrachte mich als durchschnittlichen Sünder, wäre da nicht ein übles Laster, welches anzusprechen, mir zu schaffen macht. Aber ich stehe dazu: Ich fahre gerne Auto!
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es sich für mich anfühlt, wenn ich bei Sonnenschein das Verdeck unseres Cabriolets nach hinten klappe, die Sonnenbrille aufsetze und völlig entspannt durch die Gegend surfe. Eine Schande, bedenkt man die Nutzlosigkeit dieses Vergnügen, zudem mit einem Fahrzeug, welches als Symbol für umweltbelastende Genusssucht gilt, in dessen Kofferraum nicht einmal Platz für einen Kasten Bier ist und als vernünftiges Transportmittel keine Daseinsberechtigung hat.
Leider gibt es da ein Problem für mich. Ich entstamme einer Generation, die durchweg unkorrekt aufgewachsen ist. Unser antiquierter Maßstab hat sich vollkommen verschoben. Was früher in Ordnung war, ist heutzutage eine Sünde. Das bedeutet nicht, wir hätten nicht gewusst, was gut oder schlecht, gesund oder ungesund und nett gemeint oder diskriminierend war, nur betrachtete man damals diese Unvernunft mit mehr Gelassenheit. Stellt euch vor, ich war Raucher und ab und zu stecke ich mir heute noch gerne eine an, obwohl ich seit meiner ersten Zigarette weiß, dass dies gesundheitsschädlich ist. In meiner Jugendzeit rauchte der Arzt bei der Konsultation und wir qualmten im Flugzeug. Was damals ein Rümpfen einiger Nasen auslöste, gilt heute als ein Verbrechen. So wurde manch einer zum Geächteten, der einmal ein Geduldeter war. All ihr Raucher, ihr Autofahrer, ihr Vielflieger, ihr Fleischesser, ihr Männer und all ihr Rückständigen passt auf, ihr wandelt auf dünnem Eis. Ein Fehler, und ihr werdet an den Pranger gestellt und mit der Moralpeitsche gezüchtigt.
Ich weiß, ich sollte mich nicht mit Ironie über ernste Themen auslassen, schließlich ist es Zeit für ein Umdenken und mit solchen Sünden muss man sich vermehrt kritisch auseinandersetzen. Somit kommt das schlechte Gewissen ins Spiel und Genuss wird zur Hypothek. Der Genussfaktor schrumpft auf null! Aber da gäbe es einen Lösungsansatz, glaubt mir, meine lieben Freunde: Mass halten oder weniger ist mehr! Von allem ein wenig weniger und in der Summe gesehen brächte dies einen Erfolg. Stellt euch vor, jeder reduzierte seine jährlichen Autokilometer, seine Flugmeilen, seinen Stromverbrauch und sein Fleischkonsum um die Hälfte. Vermutlich würde das System beinahe kollabieren, aber es gäbe kaum mehr CO2-Diskussionen. Drastisch, gell! Letztendlich ist alles eine Frage der Dosierung.
"Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift; allein die Dosis machts, dass ein Ding kein Gift sei.", sagte einst Paracelsus (1493 - 1541).
Ich fahre jetzt nicht mehr so viel mit dem Auto, dafür macht es noch mehr Spaß!
©Krumm, Daniel
März 2019
AUFWAND
Als wir in Irland, in der Nähe von Ardara, dieses Dolmengrab besuchten, fragten wir uns voller Ehrfurcht, wie man fähig war, vor über fünftausend Jahren solch ein Monument zu erbauen. Eine tonnenschwere Deckplatte musste auf die stehenden Tragsteine platziert werden, ein Unterfangen, welches man technisch erklären kann, aber trotzdem ist es schwer vorstellbar, dass eine ganze Sippe sich diesen Aufwand leistete, nur um jemanden angemessen zu bestatten. Jetzt könnte man getrost argumentieren, dass den Menschen in der Jungsteinzeit genug Zeit zur Verfügung stand, solch verrückte Denkmäler zu erschaffen, schließlich hatten sie nicht zu arbeiten. Das Erbauen von Dolmengräbern war also eine freizeitliche Massenveranstaltung, damit die beschäftigungslose Zeit überbrückt werden konnte und diese Völker nicht durch Langeweile zu Grunde gingen.
Leider bin ich gezwungen, euch zu enttäuschen, denn dieser Theorie widerspricht die Statistik der Kaufkraftentwicklung. Zum Beispiel musste man vor hundert Jahren für einen Liter Milch 27 Minuten arbeiten, während wir heute nur 3 Minuten dafür benötigen. Für eine Mahlzeit in einem Restaurant arbeitete man damals 192 Minuten und heute nur 35 Minuten, für ein Kilo Zucker 55 Minuten und heutzutage nur 2 Minuten. Für die Ernährung betrieb man enorm viel mehr Aufwand wie in der heutigen Zeit und rechnet man dies nun zurück in die Jungsteinzeit, dann steckten diese Menschen ihre ganze Energie und Existenz in die Beschaffung von Nahrung. Nix Freizeit! Im Gegensatz zu uns, die wir die freie Zeit mit Betätigungen füllen, welche in all den Jahren günstiger geworden sind. Zum Beispiel Telefon und Internet. Vor hundert Jahren kostete eine Minute Telefonieren nach New York 26 Arbeitsstunden, während wir heute nur noch 14 Sekunden dafür aufwenden müssen. Ergo gab es in der Jungsteinzeit keine Telefone, weil die Tarife völlig überrissen waren und niemand jemanden in New York kannte.
Wie lautet nun das Fazit? Wir können uns mit weniger Aufwand immer mehr leisten, denn abgesehen von der steigenden Kaufkraft ist unsere Arbeitszeit gesunken. 1950 arbeitete man durchschnittlich 2400 Stunden bei zwei Wochen bezahltem Urlaub. Einverstanden, das darf man so nicht vergleichen, haben wir heute doch eine eindeutig höhere Hektik und Leistungsdichte wie damals und benötigen dringend die Freizeit, um sich davon zu erholen. Eigentlich ein Witz! Wir leisten in weniger Zeit mehr, damit wir mehr Zeit zur Erholung haben. Und was bewerkstelligen wir mit dieser Zeit? Wir beschäftigen uns mit dem Telefon.
Hinterfragen wir diese Logik nicht allzu intensiv und widmen wir uns nochmals den irischen Ureinwohnern des Spätneolithikums, welche keinen Aufwand scheuten, neben der anspruchsvollen Nahrungsbeschaffung, ihrer kulturellen Geisteshaltung ein Denkmal zu setzen. Bewundernswert!
Hand aufs Herz, würden wir in unserer Freizeit mit riesigen Felsbrocken ein Monument für das Telefon erbauen? Ich habe all meinen Freunden angerufen, aber keiner hat Zeit.
©Krumm, Daniel
Februar 2019
ENTSCHLEUNIGUNG
Liebe Freunde, ich habe ein neues Mittel gegen eine allgegenwärtige Geißel der Neuzeit gefunden. Ich möchte es nicht Stress nennen, das scheint mir ein etwas abgegriffener und für ehrgeizige Karrieristen reservierter Begriff zu sein, nein, es sind die chronisch überfüllten Tage, die uns das Gefühl der permanenten Unruhe und Überforderung suggerieren. Selbst unsere Kleinsten haben einen durchgetakteten Tag ohne Spielraum für das Spiel. Egal, das lässt sich nicht mehr ändern, unsere Gesellschaft hat Fahrt aufgenommen und wer sich dagegen sträubt, verpennt das Leben oder so. Also sollten wir uns lieber mit regenerativen Erholungsprogrammen auseinandersetzen, welche uns in der knapp empfundenen Freizeit die dringend benötigte Energie für die Ansprüche der modernen Welt schenken.
Für viele mag das tägliche Fernsehprogramm die ersehnte Entspannung mit integriertem Schlaf bescheren, andere schwören auf exzessiven Sport bis zur Erschöpfung, wiederum andere pflegen Spiel und Gesellschaft auf digitaler Ebene bis die Augenlider kollabieren. In der Freizeit wird konsumiert, geleistet und gepostet, damit man ja nicht aus dem Rhythmus kommt. Obwohl uns die Wracks ausgebrannter Leistungsträger und frustrierter Mitmenschen eines Besseren belehren sollten.
Ich kann von mir nicht behaupten, dieses Hamsterrad nicht zu kennen, aber zumindest denke ich, erkannt zu haben, dass Erholung ein durchaus probates Mittel gegen Erschöpfung ist. Erholung im Sinne von Nichtstun. Ich habe diesbezüglich einen neuen Ansatz gefunden. Das Kunstmuseum! Hand aufs Herz, wann wart ihr das letzte Mal im Kunstmuseum? Ich mag Kunst, nicht durchweg alles, aber meine Schmerzgrenze gegenüber schwer verständlicher Kunst ist recht hoch angesetzt. So ist für mich der Besuch des Kunstmuseums immer ein Vergnügen, nur als Ort der Erholung habe ich diese ehrwürdigen Räume nie wahrgenommen.
Samstagnachmittags im Basler Kunstmuseum. Schon beim Betreten der Eingangshalle wird man von einer feierlichen Ruhe empfangen, ein erheblicher Kontrast zur städtischen Lärmkulisse. Steigt man erst die breite Treppe hoch in die oberen Stockwerke, dann verlieren sich die wenigen Besucher und wie in einer Kathedrale herrscht eine meditative Stille. Schwarz gewandete Gralshüter sorgen für den angemessenen Respekt vor den Kunstwerken. Keine Hektik, die Zeit steht still. Wenn man Lust hat, dann kann man die Bilder betrachten oder man kann nur so tun, als würde man die Bilder betrachten. Kein Mensch erkennt Inkompetenz, solange man verklärt auf ein Werk starrt. Man kann sich aber auch in die ausladenden Polstermöbel drapieren und sogleich einschlafen, aber widmet man sich den Gemälden, dann erlebt man eine erstaunliche Entspannung.
Stellt euch vor, ihr betrachtet dieses Bild von Robert Zünd (1883), Landschaft am Vierwaldstättersee. Man kann sich in dieser Szene verlieren und selbst bodenständige Technokraten finden darin offene Fragen, denen man sich die längste Zeit widmen kann. Wie schafft es der Künstler, dass die Kühe so lange bewegungslos stehen bleiben, bis er sie gemalt hat? Können Kühe schwimmen. Sind Kühe in Uferzonen zugelassen? Sollten hier nicht Villen stehen? Oder setzt euch vor ein monochromes Bild von Barnett Newman (1951), Day Before One und vertieft euch in vier Quadratmeter blaue Farbe. Wenn ihr lange genug auf diese Fläche starrt, dann werdet ihr von einem tiefen inneren Frieden ergriffen, was selbst eine Stunde Yoga nicht hinbekommt. Und glaubt mir, da hängen Bilder für jeden Geschmack (sehr geeignet sind die Impressionisten) und ihr werdet staunen, wie hektisch euch die Welt erscheint, wenn ihr wieder auf die Straße tretet.
©Krumm, Daniel
Januar 2019
STROMAUSFALL
Kürzlich fiel bei uns für neunzig Minuten der Strom aus, und dies abends zur Hauptsendezeit. Skandal! Dank meiner Frau, die während der kalten Jahreszeit nicht ohne den wärmenden Kerzenschein leben kann, sassen wir nicht vollkommen im Dunkeln. Wir schauten uns irritiert an, als stünde uns die Apokalypse bevor, denn wenn in der Schweiz der Strom ausfällt, dann gehen wir davon aus, dass mindestens ganz Europa im Dunkeln liegen muss. Ein Blick nach draußen bestätigt: Absolute Finsternis! Nachträglich stellte sich heraus, dass nur unsere Vorortgemeinde im Dunkeln lag.
Da die Schweiz keine Bananenrepublik ist, kann dieser Stromausfall nicht auf eine launige Infrastruktur zurückzuführen sein, sondern hatte seine Ursache mit Garantie in einer Naturkatastrophe oder einem Bombenattentat. Eine Gesellschaft, die ihre Gegenwart und Zukunft derart auf dieses Energiemedium fokussiert, leistet sich kaum eine wankelmütige Technologie. Unmöglich! Man stelle sich vor, was es heißt, wenn man sich auf unser Stromnetz nicht mehr verlassen kann. Ich wache morgens auf, und mein Smartphone und mein Elektroauto sind nicht geladen. Mit Schrecken erinnere ich mich an den 3. März 2018. Ich sass im Stadion und freute mich auf das Fußballspiel, da fiel die Flutlichtanlage aus. Nur noch die Werbebande und die Notbeleuchtung glommen vor sich hin. Das Spiel fand nicht statt. Glaubt mir, meine lieben Freunde, das war eine Katastrophe!
Horrorszenarien, wenn man bedenkt, was wir alles nicht machen und konsumieren können, wenn der Strom ausfällt. Ha, da käme aber unsere digitale Gesellschaft, die immer mehr elektrische Energie benötigt, schnell ins Trudeln. 0,4% oder 880 Terajoule oder 244,4 Mio kWh Strom verbrauchten wir 2017 mehr denn 2016, was ungefähr 46% der Jahresleistung des Rhein-Kraftwerks Birsfelden oberhalb von Basel entspricht. Wenn das so weiter geht, frage ich mich, woher der Strom kommt, wenn wir erst die Atomkraftwerke abgestellt haben werden.
Ohne euch langweilen zu wollen, muss ich euch von einem anderen lustigen Rechenbeispiel erzählen:
Die Regierung der Stadt Basel hat sich entschlossen, die nächsten zehn Jahre nicht mehr über neue Straßen nachzudenken, ausgenommen, die Finanzierung des S-Bahn-Großprojektes «Herzstück» ist gesichert oder Elektromobile einen Marktanteil von über 50 Prozent haben. Letztere Bedingung muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In Basel sind 63‘000 PWs zugelassen, also bräuchte es mindestens 31‘500 Elektro-Personenwagen. Ladet man diese PWs an den Werktagen mit je 20 kW auf, was einem Mittelwert für 100 km Fahrleistung entspricht, dann bräuchten wir jährlich nochmals etwa 25% eines Kraftwerkes.
Ich weiß, das sind theoretische Spielereien und destruktive Schwarzmalereien, schließlich sollen die benötigten Kapazitäten durch erneuerbare Energien abgedeckt werden. Um diese 31‘500 Elektromobile zu tanken, wären nur 1,2 Mio m2 Photovoltaik-Fläche oder beinahe eine Verdopplung der jetzigen Anzahl von Windrädern in der Schweiz nötig. Ein Klacks!
So, Schluss mit ätzenden Theorien! Macht euch keine Sorgen, die Politik wird es richten. Ein total zuverlässiges Stromnetz wird weiterhin genügend Strom liefern, woher, ist nicht so wichtig, Hauptsache, ich kann mein Fußballspiel sehen, obwohl es manchmal nicht schlecht wäre, dass bei manchen Spielen das Licht ausginge.
©Krumm, Daniel
Januar 2019
SÜNDENABLASS
Nächstes Jahr wird das Basler Münster tausend Jahre alt. Ein faszinierender Sakralbau, an dem sagenhafte fünfhundert Jahre gebaut, umgebaut, ausgebaut und wieder aufgebaut wurde, bis er in der aktuellen Architektur zur Vollendung kam. Ein Klacks, wenn ich bedenke, dass die Sanierung des Schänzli-Tunnels mit den umliegenden Bauten des Autobahnknotens sieben Jahre dauern wird. Entschuldigt, ich schweife ab.
Worauf ich hinaus will, ist die Frage nach der Finanzierung des Münsters. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie mittelalterliche Finanzierungsmodelle funktioniert haben, aber ich kann euch sagen, dass sie sich nur in wenigen Punkten zu den heutigen unterscheiden. Bereits damals erhob man Zölle und Steuern, etwa ähnlich ungerecht und fantasievoll wie heutzutage, auch Legate gab es, vergleichbar dem modernen Sponsoring und dann gab es da noch den Ablasshandel, der jedoch in der Gegenwart aus ethischen Gründen nicht mehr praktiziert wird. Aber im Mittelalter hatte die Kirche weniger Skrupel, bei Leuten, die es sich leisten konnten, für deren Sündenerlass etwas Geld abzuknöpfen. So wäre es durchaus möglich, dass die blutige Schuld eines brutalen Despoten als Fundament für den Kreuzgang gedient hatte und ihn wieder friedvoll schlafen ließ. Ein fragwürdiges, aber lukratives Modell.
Ihr werdet jetzt schmunzeln und euch keineswegs wundern, da solche Gepflogenheiten, wie auch die Inquisition, die Hexenverbrennung und die Feudalherrschaft im düsteren Mittelalter üblich waren. Leider muss ich an dieser Stelle den Mahnfinger in die Luft strecken und euch eines Besseren belehren. Seitdem es uns erlaubt ist, unsere CO2-Sünden mit CO2-Zertifikaten zu kompensieren, hat der Ablasshandel wieder Einzug gehalten. Sind wir saubere Schweizer doch wahrhaftige Umweltdespoten mit der größten Dichte an fetten PKWs und mit den meisten Flugmeilen auf dem Zähler, betrachtet man den damit verbundenen CO2-Ausstoß pro Kopf. Aber das ist ja nicht so tragisch, denn wir haben Geld genug, um uns freizukaufen. Selbst die ambitionierten Klimaziele vom Pariser Klimaabkommen werden wir mit Singen und Pfeifen erreichen, zumindest auf dem Papier und das lässt uns dann wieder sanft schlafen.
Mir liegt fern, mit diesen Zeilen den Sinn der CO2-Kompensation in Frage zu stellen, das gäbe eine Kolumne für sich, aber irgendwie erscheint dieser Handel leicht pervers. Ich denke, es ist weniger die Tatsache mit Geld etwas Positives zu bewirken, als die selbstgefällige Überzeugung, mit gutem Gewissen weitersündigen zu können. Wer Geld hat, muss sein Leben nicht ändern. Es riecht nach Arroganz.
Allerdings darf ich mein eigenes Verhalten nicht allzu sehr hinterfragen, finde ich doch schnell ein ähnlich verwerfliches Handeln. Da vergaß ich einmal den Hochzeitstag, eine üble Verfehlung aus der untersten Schublade, auf die meine Frau mit vielsagenden Blicken reagierte. Ich kaufte ihr einen Ring und die Sache war kompensiert. Das Ganze hatte einen heilenden Effekt, vergaß ich nie mehr einen Hochzeitstag. Ich kaufte mir ein Handy, in welches ich den jährlichen Termin eintrug. Wie ihr seht, habe ich wenigstens mein Leben geändert…
©Krumm, Daniel
Dezember 2018
KUNDENBINDUNGSPROGRAMM
Manchmal frage ich mich, was man von uns Konsumenten so hält. Vermutlich nicht viel. Warum sonst ködern uns die Supermärkte mit Kundenbindungsprogrammen, die die Welt nicht braucht? Man verführt Kinder mit billigen Stoffwichteln, Plüschtieren und Kuschelgedöns, sodass jene die Eltern terrorisieren, welche dann wiederum wie wild einkaufen gehen, damit die Kleinen diese Knuddeltiere in die Arme schließen können. Eine simple Strategie, die Eltern verzweifeln und Abfallberge wachsen lässt.
Und damit sei das angesprochen, was uns zu denken geben sollte: MÜLL!
Angenommen, solche Kuscheltiere haben eine Nutzungsdauer von einigen Wochen, um anschließend in einer Kiste zu verschwinden und nach einem Jahr im Müll zu landen, dann leisten die Großverteiler einen netten Anteil am Untergang unserer Welt.
Stimmt natürlich nicht, das ist eine vollkommen übertriebene Hypothese, schließlich lässt sich Müll hervorragend verbrennen und ganze Städte lassen sich damit heizen. Zudem darf man die Kinder nicht vergessen, die diese Plüschtiere dringend für ihre emotionale Entwicklung benötigen und uns dies mit glücksglänzenden Augen verdanken. Man muss Prioritäten setzen. Man darf nicht das Volkswohl, respektive das Kindswohl vernachlässigen, nur um keine Ressourcen zu vergeuden und sinnlose Transporte zu verhindern. CO2-Bilanz hin oder her, glückliche Kinder sind wichtiger, erst recht in der Weihnachtszeit.
Ach, sei doch nicht so ätzend und so ökologisch überkorrekt, werdet ihr jetzt einwenden, und ich werde entgegnen, dass es mir gar nicht um diese Plüschtiere geht. Mir geht es nur um Doppelmoral und Gewinnoptimierung. Googelt mal „MIGROS Nachhaltigkeit“ oder „COOP Nachhaltigkeit“, dann werdet ihr von den edlen Taten der Großverteiler regelrecht erschlagen. Einer brüstet sich sogar als Nummer eins des weltweiten Nachhaltigkeitsrankings. Egal, Hauptsache Kundenbindungsprogramm und Umsatz.
Möglicherweise liege ich mit meinen Bedenken völlig falsch, und diese Stoffwichtel werden nicht von indischen Kinderhänden zusammengenäht, sondern stammen aus einer einheimischen Manufaktur. Auch gut möglich, dass die Plüschtiere nicht in Zuchtbatterien gehalten werden, sondern großzügigen Auslauf und biologisches Futter genießen dürfen. Zertifizierte und kontrollierte Betriebe sorgen für fairen Handel und ökologische Unbedenklichkeit. Alles aus der Region und nachhaltig!
Ich gebe zu, ich mache aus einer Maus einen Elefanten. Schaut man in gängige Kinderzimmer, wo sich oft billige und fragwürdige Plastik-Spielsachen türmen, erklärt sich der Handelsüberschuss von China von selbst. Bei diesen Mengen spielen zusätzliche Wichtel kaum eine Rolle.
Na ja, sei’s drum, Hauptsache, ich habe eine warme Wohnung...
©Krumm, Daniel
Dezember 2018
AUFBRUCHSSTIMMUNG
Ein Stadtbummel in Nîmes. Meine Frau zeigte auf den Boden und meinte trocken: „Aufbruchsstimmung!“
Gemeinsames Gelächter. Ich musste einfach diese Metapher fotografieren, die man bildlich nicht besser darstellen kann. Ich wusste sogleich, damit hast du den besten Aufhänger für eine Kolumne. Zu Hause wird mir dann schon ein ansprechender Inhalt und Text dazu einfallen. Nun sind bald drei Monate vergangen und ich habe keinen Inhalt dazu gefunden. Das kann doch nicht sein! Herrscht denn bei mir keine Aufbruchsstimmung?
Äh…, gute Frage, äh…, keine Ahnung…
Der Duden definiert diesen Begriff wie folgt: Allgemeine Unruhe, die den bevorstehenden Aufbruch ankündigt. Ein schwer einzuordnender Ausdruck, der mühelos die Skala von optimistischer Vorfreude bis zu skeptischer Erwartung abdeckt, aber in erster Linie die Emotionen gegenüber bevorstehenden Veränderungen bezeichnet. Liebt man neue Herausforderungen, dann dürfte die Aufbruchsstimmung ein euphorischer Rauschzustand sein, während man als Fortschrittsverweigerer wohl eher „Oh, leck mich doch am Arsch!“ denkt. Ha, ich realisiere soeben, wie ich mich in eine Sackgasse hineinschreibe, aus der ich kaum herauskomme, ohne mich selbst einzuordnen. Bin ich ein Pionier oder ein Verweigerer?
Äh…, gute Frage, äh…, keine Ahnung…
Vielleicht bin ich zu alt, um mich als Vorreiter von irgendetwas zu fühlen und zu jung um als Fortschrittsverweigerer zu gelten. Ich bin wohl irgendetwas Undefiniertes zwischendrin, ergo dürften mich Emotionen im Vorfeld einer Veränderung kaum in Wallung bringen. Logischerweise sollte dies so sein, ist es aber nicht. Mitten im Nachdenken wird mir bewusst, je älter man wird, desto schwerer tut man sich mit Veränderungen. Gewohnheit und Trägheit lassen den Karren in tiefen Furchen fahren.
Zum Beispiel ein Update bei irgendeinem Programm oder dem Smartphone. Kaum hat man sich an etwas gewöhnt, da wird es bereits wieder erneuert. Dies ist ein Fall im Kleinen, aber da gibt es noch das Grosse, denn ganze Technologien, Prozesse und Verhalten werden permanent und immer in schnellerer Kadenz weiterentwickelt, angepasst, optimiert und digitalisiert, dass Gewohnheiten gar nicht mehr entstehen können. Und was ist ein Leben ohne Gewohnheiten? Nur noch permanente Veränderung? Sollten Veränderungen zur Normalität werden, dann kann ja keine Aufbruchsstimmung mehr entstehen. Kein Aufbruch, nur noch dauernder Umbruch.
Schreckliche Aussichten, wenn nichts mehr Bestand hat, wenn es keine ruhende Konstante mehr gibt. Ich will diesen Gedankengang gar nicht zu Ende führen, er erschreckt mich tatsächlich. Was wäre dies für eine Welt, die mir nicht mehr meinen gewohnten Platz im Stadion freihält, in der es mein Stammlokal nicht mehr gibt, in der sich die Familie nicht mehr regelmäßig trifft, in der ich morgens keinen Kaffee bekomme, in der ich vor dem Einschlafen nicht mehr lesen darf, in der es am Samstag keinen Aperitif mehr gibt oder in der die Sonne nicht mehr aufgeht.
Das wäre ein gewaltiger Mist!
©Krumm, Daniel
November 2018
MASSE
Hat man erst einmal ein gewisses Alter erreicht, dann eröffnet man des Öfteren einen Satz mit den Worten ‚Also früher, da war...‘. Das ist der Moment, bei dem das Lächeln mancher Zuhörer einfriert, während der Blick verstohlen zur Uhr schweift, oder sich einige Leser über den Sinn des Weiterlesens Gedanken machen. Es gibt nichts Langweiligeres als die Aufarbeitung früherer Zeiten, wenn dabei die Vergangenheit glorifiziert wird. Früher war alles besser! So etwa in diesem Stil.
Früher war längst nicht alles besser, aber eine Sache lässt mich trotzdem verträumt in die Vergangenheit blicken: unsere Mobilität. Ich frage mich, an was es liegt, dass wir heutzutage so mobil sein wollen, Mobilität macht doch gar keinen Spaß mehr. Völlig nervtötend. Allzu überfüllt sind die Verkehrswege, immer höher steigen Dichte und Kadenz. Stoßzeiten sind eine Zumutung. Klar, zwingen uns wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Verteilung des Wohnraums zu mehr Mobilität, aber gleichzeitig kann es sich auch jeder leisten. Mobilität ist kein Privileg und kein Luxus mehr, zudem bieten sich, deutlich intensiver wie früher, die Gelegenheiten, respektive die entsprechenden Verkehrsmittel an. Mobilität ist ein Massenphänomen geworden und die Masse wird zur Herde. Schluss mit Freiheiten frei nach Easy Rider mit Wind im Haar, es existiert nur noch ein reglementiertes Schwarmverhalten.
Wenn man zurückschaut, dann stand früher zweifelsfrei mehr Raum zur Verfügung, schließlich gab es vor 30 Jahren 2,4 Millionen weniger Einwohner in der Schweiz, ergo tummelten sich etwa ein Viertel weniger Menschen auf den Straßen und im öffentlichen Verkehr. Entspannte Mobilität zeigt sich heutzutage nur im Stau, wenn sich nichts mehr bewegt und man aus lauter Langeweile das Armaturenbrett abstaubt.
Aber Massenmobilität betrifft genauso das Reisen.
Als drastisches Beispiel sei der Reiseverkehr nach Mallorca erwähnt. 2003 flogen 19,2 Millionen Gäste nach La Palma, 2017 waren es 28 Millionen, eine Zunahme von über 45%. Ist die Insel gewachsen oder wo stapelt man die Leute hin? Es gibt Tage, da fertigt man auf dem Flughafen von La Palma über 400’000 Touristen ab, das entspricht der doppelten Einwohnerzahl von Basel. Wenn das keine Massen sind.
Ein lustiges Beispiel ist die Entwicklung der Kreuzschifffahrt, eine Industrie, welche ebenso massentauglich wurde. Da zwängen sich tausende Kreuzfahrer auf ein Boot, schippern von einer überfüllten Hafenstadt zur nächsten und stehen sich dort gegenseitig beim Fotografieren von Sehenswürdigkeiten im Weg. Venedig lässt grüßen.
Jaja, früher gab es nicht so viele Gelegenheiten und jene, die es gab, waren nicht so billig zu haben. Umkehrschluss: Schafft billige Gelegenheiten, dann kommen die Massen. Dabei spielt es keine Rolle, wie mies und umweltbelastend die Gelegenheiten sind. Was zählt, ist einzig Masse, weniger Klasse.
Ihr fragt euch jetzt nach dem Sinn meiner Ausführungen, denn außer einigen Tatsachen, die nicht neu sind, biete ich keine Lösungen für die erwähnten Probleme an. Das habt ihr goldrichtig erkannt. Ich wollte mit meinen Zeilen nur zum Ausdruck bringen, dass ich langsam in ein sentimentales Alter komme und Massen für mich ein Gräuel sind. Mehr nicht.
Einen entspannten Tag wünsch ich euch.
©Krumm, Daniel
Oktober 2018
GLÜCK
Bei der Nachbetrachtung meiner Urlaubsfotografien kam mir dieses Bild auf den Bildschirm, und ich musste schmunzeln. ‚mon petit bonheur‘ hat jemand auf die Fassade gesprayt. Da tituliert doch tatsächlich irgendwer diese Ruine als ‚mein kleines Glück‘, mit welchem Hintergedanken auch immer. Ich kann mich gut erinnern, durch die zerschlagenen Fenster geäugt und über die bescheidene Größe und Einrichtung gestaunt zu haben. Vorne beim Eingang gibt es eine kleine Küche, dahinter liegt der Wohnraum und im Obergeschoss befindet sich wahrscheinlich das Schlafzimmer. Irgendwo existiert noch ein Badezimmer mit Toilette oder so.
Trotz dem fürchterlichen Zustand und der armseligen Größe gefällt mir dieses Haus. Es hat einen spröden Charakter und möchte erst gar nicht grandioser erscheinen, als es wirklich ist. Auch wenn das verschnörkelte Geländer und die farblichen Verzierungen dem Äußeren etwas liebevolle Romantik einhauchen, bleibt es das Haus eines bescheidenen, vermutlich armen Erbauers. Aber es duckt sich nicht verschämt, sondern stellt sich mit Stolz hin, öffnet sich nach vorne und leistet sich eine Terrasse. Aber diesem Haus haftet auch etwas Tragisches an. Es wurde spät gebaut und früh verlassen, verglichen mit den Häusern des mittelalterlichen Winzer- und Bauerndorfs im Languedoc, an dessen Rand es steht. Was war geschehen? In der Küche stapelt sich noch das Geschirr, Vorhänge wiegen im Wind, unter der Spüle ist eine Gasflasche angeschlossen. Als hätte man das Haus fluchtartig verlassen.
Und dann diese drei Worte. Mein kleines Glück. Welch ein Kontrast.
Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, wie sie zu interpretieren sind. Wurden sie aus Sympathie für ein sterbendes Kleinod geschrieben oder war es purer Zynismus eines Anwohners, dem diese Ruine missfällt? Je länger ich darüber nachdenke, je mehr bin ich überzeugt, dass es einer der früheren Besitzer war, der voller Melancholie seine Gefühle zum Ausdruck brachte, denn jetzt wohnt er oder sie unglücklich in einer großen Loftwohnung in der Stadt. Er oder sie sehnt sich zurück an das bescheidene Glück vergangener Zeiten in diesem kleinen Haus. Sie waren jung, verliebt und hatten keine großen Ansprüche. Dann kam der Erfolg. Hals über Kopf zogen sie aus, schämten sich ein wenig für die schäbige Vergangenheit, wollten möglichst schnell weg, hin, in eine bessere Zukunft. Leider nahmen sie nicht wahr, wie ihnen ihr altes Leben entglitt. Ihre Beziehung zerbrach an dem neuen Reichtum, plötzlich drehte sich alles nur um Geld. Mit einem Mal fehlten ihnen die gedrungenen Räume des kleinen Hauses, wo sie gezwungen waren, sich nahe zu sein. Sie entfremdeten sich, während sie ihre Karrieren vorantrieben, und trennten sich schlussendlich. Geblieben sind wehmütige Erinnerungen an das kleine Glück.
Was für ein Kitsch!
©Krumm, Daniel
Oktober 2018
GLÜCK
Bei der Nachbetrachtung meiner Urlaubsfotografien kam mir dieses Bild auf den Bildschirm, und ich musste schmunzeln. ‚mon petit bonheur‘ hat jemand auf die Fassade gesprayt. Da tituliert doch tatsächlich irgendwer diese Ruine als ‚mein kleines Glück‘, mit welchem Hintergedanken auch immer. Ich kann mich gut erinnern, durch die zerschlagenen Fenster geäugt und über die bescheidene Größe und Einrichtung gestaunt zu haben. Vorne beim Eingang gibt es eine kleine Küche, dahinter liegt der Wohnraum und im Obergeschoss befindet sich wahrscheinlich das Schlafzimmer. Irgendwo existiert noch ein Badezimmer mit Toilette oder so.
Trotz dem fürchterlichen Zustand und der armseligen Größe gefällt mir dieses Haus. Es hat einen spröden Charakter und möchte erst gar nicht grandioser erscheinen, als es wirklich ist. Auch wenn das verschnörkelte Geländer und die farblichen Verzierungen dem Äußeren etwas liebevolle Romantik einhauchen, bleibt es das Haus eines bescheidenen, vermutlich armen Erbauers. Aber es duckt sich nicht verschämt, sondern stellt sich mit Stolz hin, öffnet sich nach vorne und leistet sich eine Terrasse. Aber diesem Haus haftet auch etwas Tragisches an. Es wurde spät gebaut und früh verlassen, verglichen mit den Häusern des mittelalterlichen Winzer- und Bauerndorfs im Languedoc, an dessen Rand es steht. Was war geschehen? In der Küche stapelt sich noch das Geschirr, Vorhänge wiegen im Wind, unter der Spüle ist eine Gasflasche angeschlossen. Als hätte man das Haus fluchtartig verlassen.
Und dann diese drei Worte. Mein kleines Glück. Welch ein Kontrast.
Man kommt nicht umhin, sich zu fragen, wie sie zu interpretieren sind. Wurden sie aus Sympathie für ein sterbendes Kleinod geschrieben oder war es purer Zynismus eines Anwohners, dem diese Ruine missfällt? Je länger ich darüber nachdenke, je mehr bin ich überzeugt, dass es einer der früheren Besitzer war, der voller Melancholie seine Gefühle zum Ausdruck brachte, denn jetzt wohnt er oder sie unglücklich in einer großen Loftwohnung in der Stadt. Er oder sie sehnt sich zurück an das bescheidene Glück vergangener Zeiten in diesem kleinen Haus. Sie waren jung, verliebt und hatten keine großen Ansprüche. Dann kam der Erfolg. Hals über Kopf zogen sie aus, schämten sich ein wenig für die schäbige Vergangenheit, wollten möglichst schnell weg, hin, in eine bessere Zukunft. Leider nahmen sie nicht wahr, wie ihnen ihr altes Leben entglitt. Ihre Beziehung zerbrach an dem neuen Reichtum, plötzlich drehte sich alles nur um Geld. Mit einem Mal fehlten ihnen die gedrungenen Räume des kleinen Hauses, wo sie gezwungen waren, sich nahe zu sein. Sie entfremdeten sich, während sie ihre Karrieren vorantrieben, und trennten sich schlussendlich. Geblieben sind wehmütige Erinnerungen an das kleine Glück.
Was für ein Kitsch!
©Krumm, Daniel
Oktober 2018
ERNEUERUNG
Beim Anblick dieser Platane, die sich im Laufe des Sommers seiner alten Borke entledigt, denke ich unweigerlich an eine Schlange, die sich häutet. Die alte Haut, welche nicht mitwächst, muss abgestreift werden, ansonsten das Tier oder in diesem Fall der Baum eingeengt würde. Wunderbar, wie die Natur solch ein Problem löst und für uns Menschen als Vorbild dient, wie wir mit einer verhärteten Schale umzugehen hätten. Die starre Hülle als Metapher für Gewohnheiten und Zwänge. Einverstanden, das hört sich etwas plakativ und reichlich abgenutzt an, trotzdem sehe ich darin eine ewige Aktualität.
Da gäbe es doch genügend Gewohnheiten und Zwänge, von denen man sich befreien könnte. Ärgernisse, die nerven und täglich grüßen wie das Murmeltier. Vielleicht sind es ja nur kleine Dinge, aber vielleicht sind es bedeutungsvolle Existenzthemen, die endlich verändert werden sollten. Leider verfügt der Mensch über keine verlässliche Erneuerungsmechanik, im Gegenteil, unsere lebendige Hülle erstarrt schnell einmal zur Schale. Lieber schlechte Gewohnheiten statt gar keine, lieber Zwänge statt Freiheit, sagt sich mancher und wartet bis der Leidensdruck hoch genug ist.
Ihr werdet euch jetzt fragen, was dieser pseudo-philosophische Diskurs soll, und ich werde euch antworten, dass dies absolut nichts zu bedeuten hat. Ich will überhaupt nichts aussagen, ich will euch nur mit platten Phrasen langweilen, so, wie man es von einer anständigen Kolumne erwarten darf. Ich ordne mich nur in die Reihe anderer medialer Meinungsäußerungen. Überall springen mir politisch und moralisch einwandfreie Zeilen entgegen. Ach, wie liebe ich diese bedeutungsschwangeren, weltverbesserischen, anklagenden, klugscheißerischen und ideologisch integeren Beiträge, welche immer wieder in den Medien auftauchen und unser Leben verändern wollen. Dabei erklärt man uns die einzig gültige Moral und die einzig akzeptable Lebensweise. Punkt! Und alle, die sich nicht an diesen Maximen orientieren, erweisen sich als Totengräber unserer Gesellschaft, wenn nicht sogar unserer gesamten Welt.
Mit Totengräber bin wohl ich gemeint, wie auch all jene, die jener Menschengattung angehören, welche den ganzen Schlamassel verursacht haben und mit der moralischen Erneuerung größte Mühe bekunden. Ihr benehmt euch wie Reliquien, wie Zeugnisse längst vergangener Tage, wirft man uns vor, und es fehlt euch gänzlich an Willen zur Verjüngung oder Metamorphose, egal, wie man es auch benennen mag.
„Alterssturheit nennt man das“, ruft der Fortschritt und fuchtelt gebieterisch mit dem Zeigefinger, „und wäre die Gesellschaft ein Automobil, dann wäret ihr verknöcherten Verweigerer die platten Reifen daran.“
Hoppla, nicht nett. Es ist gänzlich unschön, die vergangenen Sünden verursacht zu haben und gleichzeitig den Fortschritt zu behindern. Kein Wunder haben wir Alten ein schlechtes Gewissen, abgesehen davon, dass es von uns viel zu viele gibt. Verkrustete Zukunftsverweigerer nennt man solche Menschen. Also seien wir doch einsichtig, reißen uns zusammen und entledigen uns der alten Borke. Fügen wir uns dem Fortschritt und passen uns den Gutmenschen an, nicht wegen uns, nur der Moral und der heilen Welt zuliebe. Gepriesen sei die einzig richtige Zukunft.
Ich bin so froh, gibt es Gutmenschen, die uns sagen, wie wir zu denken und zu handeln haben.
©Krumm, Daniel
September 2018
BESTANDESSCHUTZ
Der Titel dieser Kolumne hört sich verdächtig nach Denkmal- und Heimatschutz an, Begriffe, denen ein fader Geschmack verstaubter Archivierung und amtlicher Zukunftsverweigerung anhaftet. Immer wieder staunt man, was als schützenswert betrachtet wird, wie Zeugnisse der brachialen Siebzigerjahre zu Zeitzeugen erhoben werden, und statt diese Betongeschwüre der Abrissbirne zu opfern, wird ihnen eine vollumfängliche Renovierung zugestanden. Na ja, Architektur ist keine präzise Wissenschaft und wenn ich heutzutage manche Bauten betrachte, dann fände ich es angebracht, das Strafrecht auf schlechte Architektur auszudehnen.
Entschuldigt meine lieben Freunde, ich schweife ab. Ich möchte euch den Bestandesschutz näherbringen, ein Grundsatz, der zumindest in der Schweiz einige durchaus positive Eigenschaften hat. Angenommen, ihr seid Besitzer eines mittelalterlichen Stadthauses oder eines Oldtimers, dann habt ihr mit Sicherheit von dem Bestandesschutz profitiert. Dieser Grundsatz schützt euch davor, dass ihr dauernd euer Haus oder euer Automobil den neusten Normen und Gesetzen anpassen müsst. So gibt es alte Häuser mit zu schmalen Treppenhäusern, zu wenig Notausgängen und Oldtimer ohne Sicherheitsgurten und Katalysator. Wirtschaftlich, aber auch historisch gesehen, wären solche Anpassungen an die Neuzeit ein Blödsinn. Es wäre unbezahlbar und der Originalzustand ginge verloren, Geschichte verkäme zu einer Fassade. Es wäre angebracht, diesem Bestandesschutz dankbar zu huldigen.
Unweigerlich stellt sich mir die Frage, wie weit der Bestandesschutz auf andere grosse Themen der Gesellschaft angewendet werden könnte. Nehmen wir die Moral, die sich wie ein Chamäleon laufend den neusten Strömungen anpasst. Da gäbe es zum Beispiel den Begriff Mohrenkopf, der vor fünfzig Jahren die unschuldige Bezeichnung eines Schaumgebäcks mit Schokoüberzug war und heute eine rassistische Beleidigung darstellt. Mit dem Bestandesschutz liesse sich die Unschuld des Ursprungs bewahren, er bliebe im Kontext seines Entstehens. Oder die Beziehung zwischen Mann und Frau. Würde da der Bestandesschutz nicht Wunder bewirken, wenn ein Kompliment wieder als Kompliment und nicht als sexuelle Belästigung angesehen würde. Klar, es sind die verwerflichen Boshaftigkeiten und die niederträchtigen Entgleisungen Einzelner und es ist nicht das Verhalten der Allgemeinheit, weshalb unsere Moral laufend ein fragwürdiges Update erhält. Nein, stimmt nicht, wir Männer seien ein grundsätzliches Problem, ist aus feministischen Kreisen zu hören, und müssten entsprechend abgeschafft werden. Es ginge sehr gut ohne uns und einige Damen bezeichnen uns Männer sogar als Müll (#MenAreTrash). Da vergehen uns sogleich die schmutzigen Gedanken. Zum Glück gibt es den Bestandesschutz, wobei ich mir nicht sicher bin, ob dies auch für uns Männer gilt.
Egal, in meinem Alter betrachtet man derartige gesellschaftliche Verwerfungen mit einer stoischen Unaufgeregtheit, denn bald werden andere Miseren wichtiger sein als trashige Männer. Was mich in meinem Alter erheblich mehr beschäftigt, ist der langsame Verlust der jugendlichen Agilität. Ich denke, hier wäre der Bestandesschutz sinnvoll angebracht.
©Krumm, Daniel
September 2018
MARKTTAG
Neulich im Urlaub, an einem Samstag in Sommières, einem verträumten, mittelalterlichen Städtchen im Hinterland des südfranzösischen Languedoc, wo es beinahe nur Einheimische und kaum Touristen gibt. Fährt man hinunter zum Meer, dann kippt dieses Verhältnis allerdings ins Gegenteil. Nur dank dem homöopathischen Interesse der Touristen an Sommières bleibt der authentische Charakter erhalten, der jeweils an Samstagen noch besser zum Tragen kommt, denn Samstag ist Markttag.
Als ich das erste Mal den Markt besuchte war mein spontaner Gedanke: OJE, FOLKLORE! Wieder einmal ein Markt voll dekorativem Kunsthandwerk, mit Anbietern selbstgemachter Konfitüre, sowie viel Schmuck, mystischen Duftstoffen und allerlei Gedöns, welchen man nicht zwingend braucht. Weihnachtsmärkte lassen grüßen.
Ha, da habe ich mich aber getäuscht.
Hundert Stände oder mehr bieten alles an, was man sich vorstellen kann. Gemüse, Früchte, Käse, Würste, Fleisch, Fisch, Gewürze, Wein, Olivenöl, Brot, Gebäck und dies in einer berauschenden Vielfalt. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten Tomaten gibt oder Ziegenkäse in vier verschiedenen Reifestufen. Das Meiste sogar bio und in einer faszinierenden Frische. Aber auch Kleider, Schuhe, Hüte, Taschen, Werkzeug, Pflanzen und vieles mehr für den täglichen Bedarf werden mehr oder weniger nett ausgestellt und verkauft. Allerdings irritiert mich etwas: Welche Frau kauft sich am Markt einen Rock, ohne ihn anprobieren zu können? Aber vielleicht kann man ihn am folgenden Samstag wieder zurückgeben, sollte er nicht passen.
Es herrscht eine wuselige Geschäftigkeit, ein anpreisendes Geschrei der Händler, die Leute schnüffeln sich wie Trüffelhunde durch die Waren und man feilscht tatsächlich um Preis und Qualität. Undenkbar, dass solch eine Atmosphäre in einem Supermarkt möglich wäre. Hier gehört es dazu, wie auch die Lust auf hervorragende Produkte. Die Lust am Essen spürt man beim Einkaufen und Verkaufen. Französisches Savoir-vivre oder die letzte Bastion des analogen Einkaufens. Ein wohltuender Gegenpart zu unserem digitalen Einkaufsverhalten, welche keine Gelegenheit für ein Beschnuppern und Prüfen der Ware ermöglicht. Selbst in den Läden verschwindet die Vielfalt, dafür wird optisch einwandfreie Ware angeboten, die nach nichts schmeckt. Da kommt mir der Film Brust oder Keule aus dem Jahr 1976 mit Louis de Funès in den Sinn (ein absolut empfehlenswerter Film, zumindest für jemanden mit meinem Humor), in dem er als Gastrokritiker und Gourmet seinen Geschmacksinn verlor, weil er miserable Lebensmittel essen musste. Er ging der Sache nach und fand unter dramatischen Umständen heraus, dass diese wunderschönen Lebensmittel künstlich am Fließband hergestellt wurden. Ich denke, das war ein visionärer Film, betrachtet man die Auslagen in den Supermärkten, zudem erscheinen immer mehr suspekte Produkte wie etwa veganes Hackfleisch.
Ja, ich weiß, ich bin ein rückständiger Lebensmittelromantiker, dem allerdings vollkommen bewusst ist, dass wir das Volk nicht mit idyllischen Wochenmärkten versorgen können, aber trotzdem ist es schön zu sehen, wie die Leute zufrieden mit vollen Taschen und ganzen Kisten nach Hause gehen und sich feine Gerichte kochen. Übrigens noch eine Randbemerkung. An den Markttagen ist es Tradition, nach dem Einkauf in einem Bistrot einen Apéro trinken zu gehen und dabei die gekauften Würste, Käse, Melonen, Baguettes aufzuschneiden und zu kosten. Kein Wirt schaut pikiert oder reklamiert, nein, im Gegenteil, er bringt gerne ein Messer und ein Brettchen, damit man gepflegt speisen kann.
Kulinarische Kultur vom Feinsten.
©Krumm, Daniel
August 2018
MARKTTAG
Neulich im Urlaub, an einem Samstag in Sommières, einem verträumten, mittelalterlichen Städtchen im Hinterland des südfranzösischen Languedoc, wo es beinahe nur Einheimische und kaum Touristen gibt. Fährt man hinunter zum Meer, dann kippt dieses Verhältnis allerdings ins Gegenteil. Nur dank dem homöopathischen Interesse der Touristen an Sommières bleibt der authentische Charakter erhalten, der jeweils an Samstagen noch besser zum Tragen kommt, denn Samstag ist Markttag.
Als ich das erste Mal den Markt besuchte war mein spontaner Gedanke: OJE, FOLKLORE! Wieder einmal ein Markt voll dekorativem Kunsthandwerk, mit Anbietern selbstgemachter Konfitüre, sowie viel Schmuck, mystischen Duftstoffen und allerlei Gedöns, welchen man nicht zwingend braucht. Weihnachtsmärkte lassen grüßen.
Ha, da habe ich mich aber getäuscht.
Hundert Stände oder mehr bieten alles an, was man sich vorstellen kann. Gemüse, Früchte, Käse, Würste, Fleisch, Fisch, Gewürze, Wein, Olivenöl, Brot, Gebäck und dies in einer berauschenden Vielfalt. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Sorten Tomaten gibt oder Ziegenkäse in vier verschiedenen Reifestufen. Das Meiste sogar bio und in einer faszinierenden Frische. Aber auch Kleider, Schuhe, Hüte, Taschen, Werkzeug, Pflanzen und vieles mehr für den täglichen Bedarf werden mehr oder weniger nett ausgestellt und verkauft. Allerdings irritiert mich etwas: Welche Frau kauft sich am Markt einen Rock, ohne ihn anprobieren zu können? Aber vielleicht kann man ihn am folgenden Samstag wieder zurückgeben, sollte er nicht passen.
Es herrscht eine wuselige Geschäftigkeit, ein anpreisendes Geschrei der Händler, die Leute schnüffeln sich wie Trüffelhunde durch die Waren und man feilscht tatsächlich um Preis und Qualität. Undenkbar, dass solch eine Atmosphäre in einem Supermarkt möglich wäre. Hier gehört es dazu, wie auch die Lust auf hervorragende Produkte. Die Lust am Essen spürt man beim Einkaufen und Verkaufen. Französisches Savoir-vivre oder die letzte Bastion des analogen Einkaufens. Ein wohltuender Gegenpart zu unserem digitalen Einkaufsverhalten, welche keine Gelegenheit für ein Beschnuppern und Prüfen der Ware ermöglicht. Selbst in den Läden verschwindet die Vielfalt, dafür wird optisch einwandfreie Ware angeboten, die nach nichts schmeckt. Da kommt mir der Film Brust oder Keule aus dem Jahr 1976 mit Louis de Funès in den Sinn (ein absolut empfehlenswerter Film, zumindest für jemanden mit meinem Humor), in dem er als Gastrokritiker und Gourmet seinen Geschmacksinn verlor, weil er miserable Lebensmittel essen musste. Er ging der Sache nach und fand unter dramatischen Umständen heraus, dass diese wunderschönen Lebensmittel künstlich am Fließband hergestellt wurden. Ich denke, das war ein visionärer Film, betrachtet man die Auslagen in den Supermärkten, zudem erscheinen immer mehr suspekte Produkte wie etwa veganes Hackfleisch.
Ja, ich weiß, ich bin ein rückständiger Lebensmittelromantiker, dem allerdings vollkommen bewusst ist, dass wir das Volk nicht mit idyllischen Wochenmärkten versorgen können, aber trotzdem ist es schön zu sehen, wie die Leute zufrieden mit vollen Taschen und ganzen Kisten nach Hause gehen und sich feine Gerichte kochen. Übrigens noch eine Randbemerkung. An den Markttagen ist es Tradition, nach dem Einkauf in einem Bistrot einen Apéro trinken zu gehen und dabei die gekauften Würste, Käse, Melonen, Baguettes aufzuschneiden und zu kosten. Kein Wirt schaut pikiert oder reklamiert, nein, im Gegenteil, er bringt gerne ein Messer und ein Brettchen, damit man gepflegt speisen kann.
Kulinarische Kultur vom Feinsten.
©Krumm, Daniel
August 2018
FRÜCHTE
Mein täglicher Weg zum Bahnhof führt mich dem Bahndamm entlang, welcher genau so aussieht, wie Bahndämme in der Regel aussehen. Unkontrollierter Wildwuchs aus krüppligen Bäumen und dichtem Gesträuch, das Ganze durchdrungen und überwuchert von allerhand Unkraut und Schlingpflanzen, wovon man in der Regel nur die fiesen Brennnesseln und die stacheligen Brombeeren kennt. Und genau diese Brombeeren lachten mich während den letzten Wochen verführerisch an und versuchten mich mit ihren beinahe lasziv geschwollenen, blauschwarzen Beeren zu verführen. Und ich konnte nicht widerstehen und nasche jetzt jeden Tag von ihnen.
Anfänglich fehlte es an Geduld, denn ich pflückte die Beeren zu früh und wurde mit fürchterlich sauren Enttäuschungen bestraft. Jetzt habe ich den Blick für die Reife, warte bis sie schön rund und prall sind und mir quasi freiwillig vom Trieb in die Hand fallen. Und dann diese Süsse, diese herrlich beerige Geschmacksexplosion, einfach köstlich. Erstaunlich, wie vollkommen eine reife Frucht schmecken kann.
Leider sind reife Früchte im Laden nicht käuflich, sie würden bereits auf dem Weg vom Produzenten in die Läden verfaulen. Schade! Dafür bekommen wir schöne Früchte. Genormt, wie aus dem 3D-Drucker und hochglanzveredelt. Perfekte Erdbeeren, welche beim Blindtest auch als feuchten Isolationsschaum durchgehen könnten oder üppige Trauben, welche auf der Zunge nach überhaupt Nichts schmecken und nicht einmal süss sind. Nebenbei kommen mir die Hors-Sol-Tomaten aus den Treibhäusern in den Sinn, die, außer dem perfekten Äußeren, nichts mehr mit Tomaten gemein haben. Im wahrsten Sinne eine Geschmacklosigkeit, welche man uns so lange vorsetzt, bis wir uns daran gewöhnt haben. Egal, Hauptsache schön, man isst ja schliesslich auch mit dem Auge. Schönheit als Fassade für schlechten Geschmack.
Ha, ein tolles Sinnbild, anwendbar auf viele Bereiche unserer Gesellschaft.
Aber vielleicht liegt es auch an uns Konsumenten, weil wir alles in perfekter Optik zu jeder Jahreszeit begehren. Wobei die Frage berechtigt ist: Wollen wir tatsächlich nur schöne Ware kaufen oder meinen die Anbieter, dass wir nur schöne Ware kaufen wollen, obwohl dies uns völlig wurscht ist? Besteht da eventuell ein gewaltiges Missverständnis? Ich wage zu bezweifeln, dass wir alle frei von Schuld sind, allerdings könnte man den Behörden einen Löwenanteil der Schuld in die Schuhe schieben, nachdem die EU Früchte und Gemüse zu normieren begann und kaum jemand diesem Irrsinn Einhalt gebot. Lustigerweise gibt es Supermärkte, die seit einiger Zeit ungewaschenes und unförmiges Gemüse im Sortiment führen, so quasi als Freakshow, nur um zu zeigen, wie hässlich ungenormtes Gemüse sein kann. Keine Angst, dieses Kuriositätenkabinett bildet einen verschwindend kleinen Anteil im Sortiment. Wir könnten dies ändern, wenn wir nur noch dieses Quasimodo-Gemüse kaufen würden, aber der Konsument läuft verunsichert daran vorbei und kauft die ästhetisch einwandfreie Kunstware.
So sind wir halt. Anspruchslose Herdentiere!
©Krumm, Daniel
August 2018
KURVENREICH
Dieses Verkehrsschild steht auf der Saalhöhe, einem idyllischen Pass (779m über Meer) mitten im Kantonsgrenzengewirr von Solothurn, Aargau und Baselland auf dem Weg von Aarau nach Frick oder Sissach. Hier, wo sich der Jura faltet, wo Wald, Weid und Feld einen beschaulichen Flickenteppich bilden, wo vornehmlich die Landwirtschaft das Land bewirtschaftet und wo sich auf der nahen Barmelweid die Zivilisationsgeschädigten erholen, steht dieses ominöse Verkehrsschild.
Na und? Werdet ihr entgegnen. Aber vielleicht seid ihr auch ein wenig irritiert, wie ich es bin. Erst, als ich bereits das Schild passiert hatte, fiel mir ein, was mich befremdete. Dieses Schild mit diesem Untertitel habe ich noch nie gesehen. Aus lauter Langeweile musste ich zuhause sofort dieses Verkehrsschild googeln und dabei wurde meine Irritation bestätigt. Dieses Verkehrsschild geht unter Gefahrensignale und gibt es in zwei Varianten, einmal als Doppelkurve nach links beginnend und einmal als Doppelkurve nach rechts beginnend, manchmal ergänzt mit der Streckenlänge (Zusatztafel 503). Die Kombination mit dem Wort ‚KURVENREICH‘ gibt es eigentlich offiziell gar nicht, zudem zeigt es die falsche Variante an. Bedenklich!
Das ist doch wurscht, werdet ihr denken, was grundsätzlich richtig ist, aber glaubt mir, führt man die Gedanken zu Ende, dann machen sich oftmals gewaltige Abgründe auf.
Erstens sehe ich in diesem Verkehrsschild einen Pleonasmus, also eine sinnlos aufgeblasene Zeichenschöpfung, ähnlich den verdoppelten Wortkombinationen, wie kaltes Eis, alter Greis, Fußpedal, Windbö, Glasvitrine oder Vogelvoliere (Liste nicht abschließend). Bei diesem Signal ist uns doch allen klar, dass einige Kurven folgen werden, das muss man nicht noch explizit mit einer Zusatztafel erwähnen. Also vollkommen überflüssig, ein absolut sinnfreies Zusatzschild, eine Vergeudung von Steuergeldern wie viele andere Straßenschilder auch.
Sucht man nach alternativen Erklärungen, wieso die Signalisationsverantwortlichen diese Zusatztafel installiert haben könnten, finde ich eine poetische Begründung. Vermutlich will man uns mitteilen, dass hier das Kurvenreich beginnt. Himmelreich, Königreich, Kurvenreich, das Reich der Kurven. Wieso nicht? Eine feinsinnige Bezeichnung für eine Strecke ohne Geraden, eine beinahe lyrische Liebeserklärung gegenüber der knorrigen Bergstraße. Irgendwie passt das, auch wenn diese Straße bereits viel weiter vorne reich an Kurven ist, möglicherweise gilt dies erst ab der Kantonsgrenze.
Ein anderer Gedanken beschäftigt mich weit mehr. Was ist, wenn trotz edlen Absichten dieses Wort falsch gedeutet wird? Bedenkt man die heutige Sensibilität gegenüber geschlechterpolitischen Begriffen, dann bewegt man sich mit ‚KURVENREICH‘ auf sehr dünnem Eis. Ist dies eine Anzüglichkeit gegenüber wohlgeformten Frauen? Ein Relikt aus der Gendersteinzeit. Ich weiß, ihr werdet jetzt die Augen verdrehen, aber wenn bereits über das Geschlecht des Figürchens auf der Verkehrsampel diskutiert wird, ist meine Befürchtung nicht unbegründet. Ich empfehle, diese Zusatztafel möglichst schnell zu demontieren, wenn man mit der schlüpfrigen Doppeldeutigkeit des Begriffs keinen Shitstorm auslösen will.
Aber vielleicht ist es auch nur ein bewusstes Statement des Straßenbauamtes gegen die Zero-Size-Models auf den Laufstegen der Modewelt? Ein Protest gegen Hungertürme und ein Plädoyer für natürliche Körper.
Ihr seht, so eine Zusatztafel kann tiefsinnige Überlegungen und tiefgründige Fragen aufwerfen. Schlussendlich ist es egal, aber die poetische Erklärung gefällt mir trotzdem am besten.
©Krumm, Daniel
Juli 2018
SCHWEISSTRANSFORMATOR
Das, was ihr auf diesem Foto sehen könnt, ist ein Schweißtransformator. Ich spüre förmlich eure Ratlosigkeit. Es ist kein Relikt aus der Steinzeit und dieses urzeitliche Gerät ist kein Museumsstück, welches die frühe Entwicklung der Schweißtechnik belegen soll, nein, mit diesem Gerät wird jetzt und heute gearbeitet, nicht in der Schweiz, aber in Indien. Ja, ihr habt richtig gelesen! Dieses Foto wurde auf einer Baustelle in Jaipur in Indien aufgenommen, wo Stahlbauer damit das primäre Tragwerk eines Gebäudes zusammenschweißen. Verrückt! Eine apokalyptische Todesmaschine, vergleichbar mit einem Atomkraftwerk ohne Reaktorhülle. Aber man glaubt es nicht, das Ding funktioniert und es wird damit gearbeitet.
Gerne würde ich diesen Schweißtransformator auf eine Schweizer Baustelle stellen und schauen, was passiert. Fassungsloses Staunen. Mit größter Wahrscheinlichkeit konfiszierte man dieses Gerät aus sicherheitstechnischen Gründen. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) würde sich einschalten, ein sofortiger Baustopp, sowie die Suche nach den Verantwortlichen für diese Verantwortungslosigkeit wären die Folgen. Einige suchten nach einer versteckten Kamera. Schnell verginge uns das Schmunzeln, denn das ist nicht lustig, das ist eine Gefährdung von Leben. Das Ganze hätte rechtliche Folgen. So ungefähr wäre die Reaktion auf einer Schweizer Baustelle.
Und in Indien? Ein Schulterzucken, denn etwas Besseres kann man sich nicht leisten und die Gefahr ist ja bekannt, also gibt man Acht. Schließlich wird solch ein Gerät erst zum Risiko, wenn man sich der Gefahr nicht bewusst ist, die von diesem Gerät ausgeht. Dazu braucht es nur einen gesunden Menschenverstand, schließlich kuschelt man ja auch mit Katzen und nicht mit Krokodilen. So frage ich mich manchmal, ob wir nicht vor lauter Reglementierung den Sinn für die Gefahr oder das Problem verloren haben. Der Staat wird uns schon sagen, was gefährlich ist und was wir nicht tun dürfen. Er wird dann eine weitere Tafel aufstellen und ein neues Gebot erlassen. Der Staat als unser Vormund.
Toll finde ich Kampagnen. Zum Beispiel die Kampagne für Grillhygiene des Bundesamtes für Lebensmittelsicherheit. Weil einige tausend, gedankenlose Leute nach unsachgemäßem Umgang mit rohem Fleisch den Dünnpfiff bekommen haben, werden Steuergelder für die Aufklärung der Bevölkerung aufgewendet. Das finde ich super! Unsere Stadt hat uns bereits einmal mit einer Kampagne versucht zu erklären, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben. Das war total genial!
Aber ich schweife ab. Also zurück zu unserer archaischen Höllenmaschine, einem eindrücklichen Sinnbild völliger Vorschriftslosigkeit. Sie ist ein lustiger Kontrapunkt zu unserer Regulierungskultur und könnte als Mahnmal gegen unsere ausufernde Bürokratie dienen. Versteht mich nicht falsch, aber manchmal würden uns eine Prise Indien guttun. Aber vielleicht wollen wir all diese Regeln. Vielleicht sind Regeln für uns ein grundsätzliches Bedürfnis und die Sehnsucht nach Vorschriften liegt in unseren Genen. Vielleicht fühlen wir uns ohne Vorschriften schutzlos und nackt. Gut möglich, dass allzu viel Freiheit unsicher macht.
Wäre eventuell eine Kampagne für mehr Mündigkeit sinnvoll?
©Krumm, Daniel
Juli 2018
GRAFFITI
Seit Jahren betrachte ich dieses Graffiti, immer dann, wenn ich auf dem Weg zum Stadion daran vorbeilaufe. Das Lächeln dieses Mädchen zieht mich jedes Mal in den Bann. Mona Lisa als Kind. Ein beinahe zärtliches und rührseliges Bild, welches so gar nicht auf die rostige Tür eines alten Bunkers aus dem zweiten Weltkrieg passt. Was für ein Widerspruch. War dies die Absicht des Künstlers? Wollte er mit der unschuldigen Lieblichkeit eines Kindes die böse Symbolik dieses Bunkers entschärfen? Vielleicht ist es ein Antikriegs-Manifest? Vielleicht hatte sich der Künstler überhaupt keine Gedanken gemacht und diese Türe nur gewählt, weil sie sich im urbanen Niemandsland befindet, wo man nachts risikolos fremden oder öffentlichen Besitz versprayen kann.
Wenn es wenigstens Kunst wäre, hört man die Kritiker meckern. Eine durchaus berechtigte Intervention, betrachtet man den Großteil der Schmierereien, die einzig zum Zweck der Beschädigung fremden Eigentums angebracht wurden. Eine jugendliche Subkultur entwickelte sich längst zu einem Ärgernis. Schlimm sind jene absolut unästhetischen und sinnfreien Kringel, sogenannte Tags, welche in der Regel jede neu sanierte Fassade ornamentieren, oder jene politischen Botschaften mit Schreibfehlern, die nebenbei auf das geistige Rüstzeug der Autoren hinweisen. Dann gibt es die großflächigen, sehr bunten Schriftzüge, die zu entziffern ein Ding der Unmöglichkeit ist und deren künstlerischen Wert mir verschlossen bleiben. Eine typische Verbreitung derartiger Sprayereien findet sich entlang aller Schienenwege. Bahnreisenden werden beinahe flächendeckend von bunten Sinnlosigkeiten begleitet, zudem zieren sie ganze Flanken von neuen Hochgeschwindigkeits- und S-Bahn-Zügen, gehören zur Grundausstattung von Güterwaggons. Eine farbenfrohe Welt, die Welt der Eisenbahn. Wieso wird das Rollmaterial nicht gleich ab Werk mit einbrennlackierten Schmierereien geliefert? Schließlich ist ein neuer Eisenbahnwaggon oder eine brachliegende Wandfläche eine Einladung für jeden Sprayer, wenn nicht sogar eine regelrechte Provokation. Mit Rucksäcken voller Farbspraydosen schleichen diese Graffiti-Guerillas bei Nacht und Nebel zu jenen geliebt verbotenen Orten, um sich dort zu verewigen. Wenn man die unendlich vielen Graffitis betrachtet, müsste in der Dunkelheit ein reger Betrieb herrschen, vermutlich stolpern ganze Pilgerströme über Brachen und durch Schotter und es kommt sicherlich auch zu Revierstreitigkeiten, wenn mehrere Sprayer gedenken dieselbe, neu verputzte Wand zu verschönern.
Aber da fällt es mir wie Schuppen von den Augen! Wer hat Interesse an diesem exzessiven Verbrauch von Farbspraydosen? Na, wer wohl? Die Farbdosenindustrie, das ist doch logisch. Eine Industrie, die wegen der heutigen Ökologie-Hysterie mit Vorurteilen zu kämpfen hat und nur noch im Underground einen prosperierenden Absatzmarkt findet. Arbeitsplätze stünden auf dem Spiel, gäbe es keine Graffitis. Graffiti als Wirtschaftsfaktor. So stellt man sich unweigerlich die Frage, ob Sprayer nicht ein anerkannter Beruf sein sollte mit einer soliden Ausbildung, gewerkschaftlich festgelegten Arbeitszeiten und durch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) geregelte Sicherheitsstandards. Das wäre doch die Idee! Bekommt man ein illegales Treiben nicht in den Griff, dann legalisiert man es und schon ist das Problem gelöst.
Ich betrachte nochmals dieses Foto und bin froh, diese rostige Bunkertür entdeckt zu haben.
©Krumm, Daniel
Juli 2018
STRASSENSCHILD
Ich möchte meine Kolumnen nicht immer mit einer doofen Frage beginnen, aber in diesem Fall scheint sie mir angebracht, da ich mir das Motiv dieses Fotos beim besten Willen nicht erklären kann. Habt ihr eine Idee, warum dieses Straßenschild doppelt installiert wurde? Das ist übrigens kein Scherz, dieses Schild steht tatsächlich in unserer Stadt, und dies schon seit Jahren.
Klar, ich könnte dieses Foto samt meiner Frage an die städtische Verwaltung schicken, und würde sicherlich eine korrekte Antwort erhalten, eine, die vermutlich nicht das erste Mal gegeben wurde. Aber ich will diese Antwort gar nicht hören, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Antwort mich glücklich machen würde. Ich rege mich dann wieder einmal unnötig auf, weil meine Denkweise höchst selten mit der Reglementierungspolitik der Stadt übereinstimmt. Da werden Steuergelder für doppelte Beschilderungen ausgegeben und unsereins nimmt man die Parkplätze weg. Genau an solchen Auswüchsen des Beamtenmolochs entzündet sich der Volkszorn, so werden Revolutionen geboren.
Aber wieso dieses doppelte Straßenschild? Will man damit die Wichtigkeit der Straße zum Ausdruck bringen? Oder deren Doppelspurigkeit? Blödsinn! Es muss sich um einen administrativen Fehler handeln, der bei der Bestellung der Schilder auftrat. Vielleicht ein Tippfehler im Bestellformular oder ein Versprecher eines Sachbearbeiters bei der mündlichen Auftragserteilung. Egal, es muss die Unfähigkeit der Verwaltung gewesen sein. Schlimm, sehr schlimm! Und weitaus schlimmer scheint die Tatsache, dass die Verwaltung es nach Jahren noch nicht geschafft hat, ihren Fehler zu korrigieren. Vermutlich hängt noch irgendwo im Nirwana der Bürokratie ein Gesuch um ‚Korrektur eines Irrtums beim Bestellen und Installieren eines Straßenschildes’. So schnell mahlen die Mühlen der Verwaltung nicht, was mich bereits wieder in Rage versetzt.
Gedankenversunken betrachte ich nochmals das Foto und frage mich, wer denn diese Meret Oppenheim überhaupt ist. Wikipedia weiß das sicher. Tatsächlich, sie ist eine surrealistische Künstlerin und Lyrikerin mit Wurzeln in unserer Stadt. Bekannt ist ihr pelzummanteltes Kaffeeservice. Ich scrolle weiter, bis mich der Schlag trifft. Ein Foto von dem doppelten Straßenschild. Da beginne ich mich für diese Frau zu interessieren und lese den ganzen Artikel. Dann recherchiere ich weiter und muss schmunzeln.
Das ist Kunst! Ein Kunstwerk, 2013 installiert von Peter Suter, anlässlich des hundertjährigen Geburtstages von Meret Oppenheim. Mist, ist das peinlich! Ich kann nicht einmal Kunst von einem Verwaltungsirrtum unterscheiden. Was für ein Kunstbanause bin denn ich? Diese Schlappe trifft mich hart, mich, der von sich überzeugt war, ein kultureller Feinschmecker zu sein. Hätte ich die Rückseite des Schildes angeschaut, dann hätte ich den Spiegel gesehen, dann wäre mir vielleicht klargeworden, dass es sich nicht um ein normales Straßenschild handeln kann. Aber nein, man sieht nur die Gelegenheit, der Verwaltung mit Hohn und Spott eins aufs Dach zu geben. Dabei hat die Stadt nur auf eine sympathisch zurückhaltende Weise Kunst im öffentlichen Bereich ermöglicht.
Aber man hätte es anschreiben können, dass Kunstbanausen wie ich auch merken, was Kunst ist. Ich werde mich bei der Stadtverwaltung beschweren.
©Krumm, Daniel
Juni 2018
LANGSAMVERKEHR
Wie ich auf der Webseite des Schweizerischen Bundesamtes für Straßen (ASTRA) gelandet bin, hat viel mit Zufall zu tun, und ich wollte bereits die Seite wegklicken, da bemerkte ich auf der Seitenleiste unter den Themen den Begriff ‚Langsamverkehr‘. Meine Neugier war sogleich geweckt, denn da steht geschrieben:
Der Langsamverkehr (Fuß- und Veloverkehr, Wandern usw.) weist ein erhebliches, derzeit noch ungenutztes Potenzial zur Verbesserung des Verkehrssystems, zur Entlastung der Umwelt (Luft, Lärm, CO2) und zur Förderung der Gesundheit auf.
Ja, da kann man nicht widersprechen, zumindest nicht auf den ersten Blick und ohne diese These hinterfragt zu haben. Wie ich allerdings darüber nachzudenken beginne, äufnen sich lauter offene Fragen und Irritationen. Bereits den Begriff ‚Langsamverkehr‘ muss ich in Frage stellen, wenn er mit dem Fahrrad in Verbindung gebracht wird. Gibt es noch jemanden, der langsam Fahrrad fährt? Seitdem ich als Automobilist in der 30-Zone von jedem Fahrrad überholt werde, sehne ich mich nach den guten alten Zeiten, in der nur eine kleine Zahl von sportlich ambitionierten Rennrad-Enthusiasten mit ihren filigranen Renngeräten auf Land- und Passstraßen anzutreffen und die restlichen Fahrradfahrer gemütlich auf ihren Dreigängern unterwegs waren. Heutzutage, nach einer inflationären Zunahme hipper Fixies, fett bereifter Mountainbikes, vierundzwanziggängiger Citybikes mit Körbchen und Kinderanhänger, hässlicher E-Bikes und sperriger Cargo-Schwerlast-Elektroräder, fühlt man sich als Automobilist, aber auch als Fußgänger wie ein Torwart – immer in der Defensive.
Das Gefährdungspotential verschiebt sich weg vom Automobil hin zum Fahrrad, ganz logisch, schließlich gibt es mehr und schnellere Fahrräder, sowie weniger Platz für Autos. Eine politisch avisierte Entwicklung, weshalb in den Städten die Verkehrs- und Parkflächen des motorisierten Individualverkehrs zugunsten des Langsamverkehrs und des öffentlichen Verkehrs komprimiert werden. Den letzten Satz habe ich mir nicht aus den Fingern gesogen, nein, das kann man sich alles aus den Ausführungen auf der Webseite des ASTRA zusammenreimen. Jetzt denkt ihr, ich werde jetzt mit viel Zynismus zu einem verbalen Rundumschlag gegen alle ökologisch korrekten Verkehrsteilnehmer ausholen. Irrtum! Im Gegenteil, ich befürworte die entschleunigte Art der Fortbewegung, auch wenn ich liebend gerne hinter dem Steuer eines tiefliegenden Cabriolets sitze und auf einsamen Bergstraßen die Fliehkräfte auslote. Was ich nicht verstehen kann, ist die Tatsache, dass das Elektro-Fahrrad dem Langsamverkehr zugeordnet wird, zudem spreche ich dem Elektro-Fahrrad die ökologische Unbedenklichkeit ab.
Und dann gibt es da noch mein Bauchgefühl. Parallel der Zunahme des Zweiradverkehrs meine ich eine Verrohung der Sitten auf den Straßen und eine moralische Arroganz vieler Zweiradfahrer gegenüber dem Automobilisten zu spüren.
Fahrrad lieb – Auto böse. Gute Menschen – schlechte Menschen.
Und alle, die lieb sind, dürfen sich etwas mehr erlauben, so quasi als Ökobonus. So entwickelt sich in den Städten eine neue Klassengesellschaft, welche sich nicht mehr durch Reichtum und Macht definiert, sondern an der ökomoralischen Reinheit, respektive an dem ökologischen Fußabdruck gemessen wird. Da kommt der Langsamverkehr wie gerufen, welcher gemäß ASTRA stark ausgebaut, gefördert und effizienter gestaltet werden muss. Noch effizienter? Na, dann machen wir uns mal auf was gefasst!
Übrigens plädiere ich weiterhin, dass die Elektro-Fahrräder zum motorisierten Individualverkehr gezählt werden, und im Gegenzug die Straßenbahn dem Langsamverkehr zugeordnet wird. Unglaublich, wie langsam die durch die Innerstadt schleicht...
©Krumm, Daniel
Juni 2018
PERFEKTION
Ich bin leider ein Perfektionist.
Na und? Ein Problem, welches mit dem Adverb ‚leider‘ angedeutet wird, kann in diesem Bezug kaum der Rede wert sein. Vermutlich ein klassisches Luxusproblem, etwa so fragwürdig, wie ein Hundespielplatz auf dem Marktplatz, wie die Reglementierung der Weihnachtsbeleuchtung im öffentlichen Bereich, wie die Förderung von Elektromobilität oder wie die Einführung veganer Kost in Kindergrippen. Alles bewegende Probleme, die wir vor einigen Jahren nicht kannten, nicht weil früher alles besser war, nein, weil wir damals noch nicht auf dem Wohlstandsniveau angekommen waren, welches wir heute geniessen dürfen. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die werden erst dann zu einem Problem, wenn die wirklichen Probleme auszugehen drohen.
Betrachte ich den Zustand unseres Landes, dann ist dieser noch weit weg von Perfektion, aber vergleicht man dies mit anderen Ländern, dann rücken wir deutlich näher an eine vage Vorstellung von Vollkommenheit. Alles ist akkurat reglementiert und geplant oder zumindest praktisch und geschmackvoll gestaltet. Als Perfektionist sollte mich diese leicht arrogante Erkenntnis glücklich machen. Nur ist dem leider nicht so. Warum denn das? Das habe ich mich auch gefragt, wie ich in Ländern zu Besuch war, die mich begeisterten, welche aber weit weg von jeglicher Vollkommenheit sind. Länder, in denen Häuser grundsätzlich bröckeln, Strassenbeläge sich noch an Kutschen erinnern können, der Gang aufs Klos eine Herausforderung ist, öffentlicher Verkehr nichts mit Bahnen und Bussen zu tun hat, Polizisten schöne Uniformen haben, es keine Elektro-Fahrräder gibt, man gefährliche Dinge markiert, aber nicht entfernt, Defektes nicht zwingend ausgewechselt wird oder am Sonntag die Städte nicht ausgestorben sind. Eigentlich sollten mir Chaos, Zerfall, Anarchie und Unordnung widerstreben, wenn da nicht meine dunkle Seite wäre. Ja, ich bin wie Dr. Jekyll und Mister Hyde. Perfektion und Authentizität. Zwei Eigenschaften, die wie Wasser und Öl, wie Darth Vader und Luke Skywalker, nie in trauter Zweisamkeit harmonieren werden. Im selben Mass, wie ich Perfektion, Qualität, Ordnung und Zuverlässigkeit zu schätzen weiss, liebt meine dunkle Seite das mediterrane Lebensgefühl, das Hedonistische, die Musse und das Unverfälschte. Eigenartigerweise trifft man diese beiden Gegensätze selten in friedlicher Koexistenz. Schade!
Die Welt verkäme zu einem Museum, gäbe es da nicht die Spuren des Lebens, und handkehrum versänke die Welt in der Kloake, wäre da nicht die ordnende Hand. Die Welt widerspricht sich oft und ist voller Gegensätze. Schwarz und Weiß, schön und hässlich, reich und arm, Fleischesser und Veganer, linksautonom und rechtsradikal, Donald und Kim, Stadt und Land und nicht zu vergessen, Helene Fischer und AC/DC. Sucht man den Kompromiss zwischen den Gegensätzen, dann werden die Eigenschaften mittelmäßig. Auch kein faszinierender Zustand. Wer lebt schon gerne im Mittelmass, es reicht doch schon, dem Mittelstand anzugehören.
Ich werde jetzt nach Hause gehen und etwas Unordnung schaffen. Es ist Zeit, dass die Zeitschriften nicht mehr parallel zur Tischkante liegen, die Schuhe nicht mehr akribisch aufgereiht im Schrank stehen und die Bücher nicht mehr alphabetisch geordnet sind. Es ist Zeit, etwas gegen die Perfektion zu unternehmen. Können wir Schweizer das überhaupt?
©Krumm, Daniel
Juni 2018
DICHTESTRESS
Kennt ihr den Begriff Dichtestress? Ja? Wunderbar! Kennt ihr auch das Gegenteil von Dichtestress? Nein? Da bin ich aber froh, denn trotz langem Nachdenken finde auch ich kein Wort dafür. Ich weiß, Dichtestress war einmal Unwort des Jahres, dies, weil im Vorfeld einer eidgenössischen Abstimmung, bei der es sich um die drohende Überfremdung und Übervölkerung unseres kleinen Landes drehte, einige Leute damit Stimmung machten. Glaubt mir, ich kenne Dichtestress. Als Pendler nutze ich jeden Tag den öffentlichen Verkehr, eine Erfahrung, die einem diesen Begriff sehr deutlich vor Augen führt und ihn sogar körperlich erfahren lässt. Prinzipiell nicht lustig.
Ich stellte mir diese Frage in einem Hochtal im Irischen Donegal. Der Blick schweifte dabei über moorige, mit Erika, Binsen, gelbem Stechginster, violetten Rhododendren und Moos bewachsene Höhen, die sich sanft gewölbt, wie wollige Schafsrücken, in die Landschaft schmiegten. Ein kleiner Bergbach mäanderte mit einschläferndem Geplätscher. Kein Mensch war zu sehen. Vielleicht zeugte ein verfallenes Cottage von einer ehemaligen Präsenz von Menschen, ansonsten sah man nur Schafe. Weiße Punkte auf einem grünen Teppich. Die Landschaft wurde zu einem Gemälde, nur der Wind war zu hören. Urlaub für die Sinne.
Das ist das Gegenteil von Dichtestress.
Kaum in der Nähe einer Internetverbindung angekommen, habe ich mich schlau gemacht, und dank Wikipedia fühle ich mich sogleich in meinem Empfinden bestätigt. Auf 70'000 Quadratkilometern verteilen sich 4,8 Millionen Iren, während sich auf 41'000 Quadratkilometern Schweiz 8,5 Millionen Schweizer und Zugewanderte drängen. Somit leben in der Schweiz dreimal mehr Einwohner pro Quadratkilometer denn in Irland! Übrigens leben mehr als doppelt so viele Schafe als Menschen auf der grünen Insel. Dies nur nebenbei. Verglichen mit der Schweiz, herrscht in Irland ein menschliches Vakuum, ein offensichtlicher Gegensatz zu unserem Land, welches unter drohendem Verkehrsinfarkt und wuchernden Siedlungsgeschwüren leidet. Keine Angst, ich werde mich nicht in eine sozialkritische Betrachtung unserer Immigrationspolitik versteigen, dazu habe ich keine Lust, aber ich habe plötzlich eigenartige Bilder vor Augen.
Ich stelle mir vor, wie sich der Verkehr ineinander verkeilt. Nichts geht mehr, alles steht still, die Straßen werden zu einem Parkplatz, die Leute gehen wieder zu Fuß. Man übernachtet bei der Arbeit und kommt nur am Wochenende nach Hause. Das Zuhause schrumpft zu einem Konzentrat, mehr Platz ist nicht vorhanden oder zahlbar. Ein schlechter Film. Ich verdränge die Bilder.
Ich schaue aus dem Fenster, verliere mich in der Betrachtung der Irischen Landschaft und warte, bis meine überreizte Fantasie wieder zu Sinnen kommt.
©Krumm, Daniel
Juni 2018
TIDE
Westport, ein Städtchen an der Westküste Irlands, schön herausgeputzt, aber noch immer spürt man die Spuren der harten Vergangenheit. Zerfall und Aufbruch, Hand in Hand. Ein Land voller Dramatik, bestens zur Schau gestellt durch seine opulente Landschaft. Ich liebe es!
So stehe ich hier am Quai und schaue über die ausgefranste Bucht und frage mich, wo das Wasser geblieben ist. Es herrscht Ebbe. Braune Felsen, bewachsen mit schlaffen Algen, säumen das Ufer und bis weit hinaus sieht man nur Schlick mit unzähligen kleinen Häufchen, die vermutlich von Krebsen oder irgend solch einem Getier stammen. Als hätte jemand den Stöpsel gezogen. Schiffe hängen schräg in den Seilen, wie angezählte Boxer, andere Boote scheinen dieses dauernde Auf und Ab nicht verkraftet zu haben, weshalb sie wie Wasserleichen im Schlamm stecken. Nur wenige Rinnen sind noch mit einem letzten Resten Wasser gefüllt, ein Geruch nach totem Fisch, Algen und abgestandenem Guinness erfüllt die Luft. Eigentlich kein schöner Anblick.
Je länger ich so dastehe, je ernsthafter stelle ich mir die Frage, wohin denn das Wasser geflossen ist. Ich weiß, die Gezeiten werden durch die Anziehungskraft von Mond und Sonne gesteuert, aber legt man die wissenschaftliche Erklärung für einmal beiseite, dann ergeben sich schon einige interessante Überlegungen. Vielleicht ist die Erde doch eine Scheibe, deren Rotation leicht eiert, weshalb das Wasser, je nach Schräglage, von einem Ende zum anderen schwappt. Zugegeben, eine etwas abstruse Schlussfolgerung, die sich allzu fern wissenschaftlicher Tatsachen bewegt. Ich schiebe diesen Gedanken zur Seite und folgere logischerweise, dass dieses Wasser, welches hier fehlt, sich an einer anderen Stelle auftürmen müsste. Aha, ich habe allerdings in der Schule gelernt, dass sich Wasser, außer in verpackter Form, nicht auftürmen lässt, also widerspricht sich die Physik in dieser Beziehung komplett. Irgendjemand lügt uns an. Und wir sprechen hier nicht von zwanzig Zentimetern die fehlen, nein, sage und schreibe über drei Meter, ein ganz großer Haufen Wasser.
Egal, ich versuche dieses Phänomen als gottgegeben zu betrachten und muss im selben Moment feststellen, wie ähnlich sich mein Bankkonto verhält. Ebbe und Flut im Monatstakt. Auch in diesem Fall ist mir oftmals nicht klar, wie sich das Geld verschiebt und bei wem es sich auftürmt. Oder meine Laune. Wo geht denn die hin, wenn sie bei mir sinkt? Steigt dann bei jemanden anderen die Gemütslage? Und das Leben? Wird im selben Moment ein Leben geboren, wenn meines erlischt? Und da wird mir plötzlich klar, dass es nicht weiter verwunderlich ist, wenn ich bei Vollmond nicht schlafen und andere nicht Auto fahren können. Ich wünsche jener Person viel Erholung mit meinem Schlaf und im Gegenzug verdanke ich irgendjemandem auf dieser Welt meine außerordentlichen Fahrkünste.
Ich bin mir nicht sicher, ob meine Überlegungen richtig sind, dazu fehlt leider der wissenschaftliche Beweis, aber ich werde mich künftig vermehrt dieser Thematik widmen. Für den Moment bewundere ich die wundersame Wirkung von Sonne und Mond.
©Krumm, Daniel
Mai 2018
VERSCHWÖRUNG
„Hei Hugo, altes Haus, schon lange nicht mehr gesehen.“
„Oh Rudolf, schön dich zu sehen. Du hast recht, das ist sicher schon zwei Monate her, als wir das letzte Mal zusammen ein Bier getrunken haben.“
„Wirklich? Die Zeit läuft wie verrückt.“
„Sag nichts, ich habe das Gefühl, da bescheißt uns jemand.“
„Ja, ja, die Zeit verrinnt immer schneller, je älter man wird.“
„Siehst du das auch so? Darüber habe ich intensiv nachgedacht.“
„Äh, und was kam dabei heraus?“
„In Wahrheit läuft die Zeit immer noch gleich schnell, aber uns Rentnern hat man mit den vielen Medikamenten, die man im Alter verschrieben bekommt, eine Substanz untergejubelt, welche eine schnellere Zeit simuliert, damit wir früher sterben und somit die Rentenkasse nicht so stark belasten.“
Langes Schweigen.
„Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Gedankengang sauber zu Ende gedacht ist, aber Verschwörungstheorien sind zurzeit in Mode.“
„Du zweifelst vielleicht noch, aber wenn du so intensiv darüber nachgedacht hättest wie ich, dann wärst du von meiner These überzeugt.“
„Vielleicht. Möglich. Mit genügend Alkohol könnte eventuell auch ich auf solch eine These kommen. Wollen wir einen Wein trinken gehen?“
„Gute Idee! Komm, wir gehen in die Harmonie.“
„Herr Ober, einen halben Beaujolais mit zwei Gläsern. Bitte.“
„Aber wie kommst du auf diese These?“
„Überleg doch mal! Da schmiedet die Politik ein gewaltiger Komplott mit dem Gesundheitswesen. Warum werden die Gesundheitskosten und die Krankenkassenprämien laufend höher? Das liegt an diesen Substanzen, die man uns verabreicht. Die sind teuer, und weil wir immer mehr Alte werden, schrauben sich diese Zusatzkosten ins Unermessliche. Eine Spirale, die erst abbricht, wenn wir wegen der zu schnellen Zeit zu sterben beginnen.“
„Aha! Lass uns zuerst anstoßen und einen Schluck nehmen. Zum Wohl mein Freund.“
„Zum Wohl.“
Noch längeres Schweigen.
„Wenn ich dich richtig verstehe, dann läuft die Zeit noch nicht schnell genug für uns, sonst wären wir bereits tot.“
„So ungefähr.“
„Aber etwas verstehe ich nicht. Viele Alte sterben doch trotzdem.“
„Zufall, respektive statistische Ausreißer. Wenn die Substanz erst einmal wirkt, dann werden wir kurz nach der Pensionierung dahingerafft. Wir sterben weg wie die Fliegen.“
„Scheiße! Das ist ja schrecklich.“
„Herr Ober, bitte, noch einen Halben.“
„Aber gibt es denn keine Lösung für dieses Dilemma? Du hast doch darüber nachgedacht.“
„Schwierig. Wir könnten sofort alle unsere Medikamente absetzen, aber das wäre unsinnig, dann wären wir morgen schon tot. Aber wenn wir die Dosierung reduzieren, dann würde die Zeit entsprechend langsamer drehen.“
Sehr langes Schweigen.
„Bist du sicher?“
„Absolut! Was für eine Frage.“
„Ja, hast du es bereits ausprobiert?“
„Aber ja doch! Mit einem scharfen Messer schneide ich bei jeder Tablette eine kleine Scheibe ab, etwa zwanzig Prozent. Diese Scheiben ergeben nach jedem fünften Mal wieder eine ganze Tablette. So spare ich Kosten und die Zeit dreht erst noch langsamer. Wie sagt man heutzutage: eine Win-win-Situation.“
„Und wie kontrollierst du das mit der Zeit?“
„Gar nicht. Das spürt man. Alles ist gemächlicher, selbst mein Zittern ist langsamer geworden.“
„Aha!“
Außerordentlich langes Schweigen.
„Herr Ober, wir nehmen noch einen Halben.“
©Krumm, Daniel
Mai 2018
ANALOG
Der Diamant setzt sanft auf, rutscht knackend in die Rille, und sogleich beginnt es leise zu knistern, als brenne irgendwo ein Feuer. Aus dem Nichts, aus einem raumlosen Nirgendwo heraus, beginnen leise die Streicher zu spielen, mit ihrer so typischen Melancholie, klagend, aber mit erwärmender Harmonie, langsam steigernd. Ich starre an die weisse Wand, trotzdem sehe ich die Violinisten, wie sie sich vollkommen synchron wiegen, wie ein Ährenfeld im Wind, wie sie körperlich mit der Musik verschmelzen, und langsam beginne auch ich die Musik zu fühlen. Sie wird lauter, füllt immer mehr den Raum. Dann kommt das Orchester mit jener Macht ins Spiel, dass sich mir die Körperhaare aufstellen und die Schallwellen die Eingeweide erbeben lassen. Die Hörner, die Bässe, die Pauken mit einem brachialen Einsatz. Die Dynamik ist atemberaubend, wunderbar das räumliche Empfinden, als sässe man mitten im Orchester, und dann diese Natürlichkeit der Instrumente. Alles tönt so, wie es tönen sollte. Einfach wundervoll, einfach monumental!
Seufzend würge ich mich aus den Kissen, gehe zum Verstärker und regle die Lautstärke zurück. Die Nachbarn werden mir dankbar sein, wenn die Paukenschläge nicht mehr die Gläser in den Vitrinen tanzen lassen. Leider geht mit der Vernunft auch ein derber Verlust an Vergnügen einher. Nur noch seicht wabert der Klang durch den Raum, weiterhin mit Finesse und Tiefe, aber das Erhabene fehlt ein wenig. Vielleicht sollte ich von Vivaldi absehen und eine jazzige Platte von Style Council auflegen? Gute Idee! Ich fahre den Tonarm hoch, nehme die Schallplatte vom Teller und schiebe sie in die Hülle zurück. Ich blättere kurz durch die alphabetisch einsortierte Sammlung im Bücherregal und werde fündig. Mit einigen routinierten Bewegungen lasse ich die Vinylscheibe aus der Hülle mit dem bereits etwas abgegriffenen Schwarzweissbild gleiten, lege sie auf den Plattenteller, und lasse ihn mit dreiunddreissig Touren drehen. Während einigen Umdrehungen halte ich die Staubbürste sorgfältig auf die feinst gerillte Oberfläche, wische dann den Staub mit einer eleganten Geste nach aussen. Vorsichtig schwenke ich den Tonarm über den Beginn der Rille und senke den Arm sanft ab.
Jedes Mal, wenn das Ritual des Plattenauflegens von den ersten Takten der Musik abgelöst wird, muss ich auf eine irritierende Art und Weise meine Seelenverwandtschaft zu diesem Plattenspieler feststellen. Kein Witz, ich könnte mir durchaus vorstellen, im nächsten Leben als Plattenspieler geboren zu werden. Als analoges Gerät in einem lackierten Nussbaumgehäuse, mit sensibler Technik und einem beeindruckenden Können. Ein mechanisches Gerät ohne jeglichen Zwang zur Effizienz, aber mit musikalischer Sinnlichkeit. Quasi ein anachronistischer Gegenpol zum digitalen Fortschritt, eine analoge Oase in der unendlichen Datenwüste. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich für die Welt aus Einsen und Nullen geschaffen bin. Sich der Zukunft zu verweigern wäre allerdings falsch, aber sich leicht quer zu stellen, zeigt zumindest eine kritische Sicht auf ein System, welches vieles einfacher, aber nicht besser macht.
Aber macht euch keine Sorgen, ich werde euch nicht mit einem verklärten Blick in die Vergangenheit, in der sowieso alles besser war, langweilen. Ich will euch nur zu verstehen geben: ich funktioniere analog. Selbst bei meinem Hirn bin ich der Meinung, dass dort noch einige Funktionen durch mechanische Vorgänge geregelt werden. Ich meine manchmal zu hören, wie gewisse Zahnräder nicht mehr sauber einrasten, Gestänge zu viel Spiel haben und das Schmieröl längst einmal gewechselt werden sollte. Das es klar ist, ich rede von meinem Hirn, und nicht von meinen Gelenken. Jene sind eine ganz andere Geschichte.
©Krumm, Daniel
Mai 2018
HORIZONT
Mein Horizont ist sehr begrenzt, weniger mein geistiger, mehr jener, der durch die Fenster unserer Wohnung zu erkennen ist. Da kann man keine flammende Sonne hinter Bergrücken oder im Meer versinken sehen, da modellieren sich weder Landschaften noch Panoramen, da bewundern wir nur die zehn Meter entfernte Fassade des benachbarten Hauses. Eine kleine Welt. Immerhin sind wir Mieter einer Wohnung im Erdgeschoss mit Gartensitzplatz. Wenn nun jemand zwischen den Zeilen einen zynischen Unterton zu erkennen meint, dann muss ich jene bitter enttäuschen. Als urbaner Mensch ist man diese Kategorie von Horizont gewohnt und ein Gartensitzplatz gilt bereits als großräumiges Privileg. Ich kenne Leute, die wohnen in der Altstadt, deren Horizont endet nach vier Meter, die Fenster sind Schießscharten, ein Balkon oder ein Gartensitzplatz fehlt gänzlich, und dafür zahlen sie ein Vermögen. Oder der Japaner, von dem ich gelesen habe, der in Tokio ein Grundstück von dreißig Quadratmeter Fläche geerbt hat und nun ein Haus darauf baut. Daraus ließe sich schließen, dass die Bedeutung des Horizonts vollkommen überbewertet wird. Ist das Gerede über den Horizont nur klischeehafte Symbolik? Mag sein, und trotzdem verbinden wir Freiheit, Toleranz und Humanismus mit einem weiten Horizont. Wenn solch philosophische Grundwerte mit dem weiten Horizont in Verbindung stehen, dann müssten im Umkehrschluss Engstirnigkeit, Intoleranz und sämtliche charakterliche Defizite ihre Ursache in einem eingeschränkten Horizont haben. Der minimalste Horizont ist sicherlich das Brett vor dem Kopf.
Nach all diesen Überlegungen muss ich mir ernsthaft die Frage stellen, ob ich nicht logischerweise ein engstirniges und intolerantes Arschloch bin. Vielleicht ist doch, entgegen meiner anfänglichen Meinung, mein geistiger Horizont eng begrenzt, und ich betrachte das Leben und die Welt aus einer völlig kurzsichtigen Optik. Vielleicht sollte ich ein Motorrad kaufen, mich auf den Sattel schwingen und in den Sonnenuntergang fahren oder mühselig einen schlecht erschlossenen Berggipfel erklimmen, damit sich endlich mein Horizont erweitert. Haben wir Schweizer überhaupt eine Chance aus dieser Engräumigkeit zu entkommen? Unser Blick endet schnell an der nächsten Bergwand und wenn man endlich in der Höhe eine Fernsicht gefunden hat, dann schweift das Auge schnell einmal über die naheliegende Landesgrenze ins Ausland. Abgesehen davon haben wir kein Meer.
‚Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer!‘ skandierte einst eine frustrierte Jugendbewegung in den Achtzigerjahren, forderten damit Geld für die Kultur, aber formulierten mit dieser Parole insgeheim den Wunsch nach einer Erweiterung des Horizonts. Die Alpen einzuebnen, scheint mir selbst für Schweizer Verhältnisse ein überrissenes Projekt, aber eine Abrissbirne zu bestellen, um das Nachbarhaus zu plätten, wäre ein vertretbarer Aufwand für eine Horizonterweiterung.
Ich werde mal anrufen, um zu fragen, was das kosten könnte.
©Krumm, Daniel
Mai 2018
SCH****!
Ich hoffe, ihr seid nachsichtig mit mir, aber ich hatte keine Wahl, das musste ich einfach fotografieren. Unzählige Fliegen, die sich genüsslich über einen frischen Pferdehaufen hermachen. Warum ich das musste, fragt ihr euch, und ich muss zugeben, dies in jenem Moment noch nicht genau gewusst zu haben. Allerdings war mir klar, es ist ein Sinnbild für irgendeinen Missstand in der Gesellschaft oder irgendetwas, was mir gehörig auf den Senkel ging.
Jetzt, zu Hause am Schreibtisch, gestaltet sich die Interpretation des Bildes weitaus schwieriger, als gedacht. Es ist nicht so einfach, einen Sinn für dieses Bild zu finden. Ich zäume den Gaul quasi von hinten auf, so wie die Wohlstandsgesellschaft, die aus Mangel an echten Problemen, welche erfindet.
Egal, es gilt also die Symbolik dieser durchaus sehr natürlichen Szene zu ergründen. Scheiße und eine große Ansammlung von Lebewesen sollten sich doch problemlos auf unsere Gesellschaft projizieren lassen, aber schnell muss ich feststellen, dass ich mich dabei in seichten Klischees verliere.
- Das Volk frisst nur noch Scheiße! Die passende Überschrift zu den gängigen Lebensmittelskandalen.
- Die Masse interessiert sich nur für Scheiße! Die provokative Überschrift zu den gängigen Fernsehprogrammen.
- Der unmündige Bürger folgt jeder Scheißparole! Gedanken der Opposition nach verlorener Wahl.
- Die Jugend erliegt jedem Modetrend! Gedanken von Erwachsenen zu einem neuen Trend, der Scheiße aussieht.
- Wenn der etwas sagt, dann kommt nur Scheiße raus! Wütende Worte linker Journalisten über einen Weltpolitiker.
Ratlos sitze ich vor dem Foto und meinen Notizen. Gibt es tatsächlich keine neue Widrigkeit in dieser Welt, die mit diesem Bild an den Pranger gestellt werden könnte? Gibt es nichts Verwerfliches, worüber noch nicht ausgedehnt berichtet wurde? Ich muss umdenken. Vielleicht ist das Bild zu drastisch? Vielleicht sollte ich von dieser derben und holzschnittartigen Bildsprache Abstand nehmen und eine feinere Klinge wählen.
Ich bin enttäuscht, denn somit ist dieses Foto als Aufhänger für einen kritischen Text gestorben. Das Bild ist nur noch ein witziger Schnappschuss, mehr nicht. Schade! Die ganze Euphorie im Eimer. Ein letztes Mal suche ich verzweifelt nach einer kreativen Verwertung dieses Bildes und will soeben verärgert die Aufnahme löschen, da erinnere ich mich wieder an den Moment vor dem Knipsen des Fotos. Ich kam auf diesem Feldweg gelaufen, passierte bereits den x-ten Pferdehaufen, alle dick überzogen mit Fliegen, die sich explosionsartig in eine schwirrende Wolke verwandelten, wenn man sich zu ungestüm näherte, und ich hoffte inständig, dass keine dieser Viecher sich auf mich setzen würden. Ich stellte mir vor, wie sie ihre fäkalienverschmierten Beine an mir säuberten. Ekelhaft! Und wer trägt an diesem Dilemma die Schuld? Die Reiter!
Ja, genau, da haben wir den zum Himmel stinkenden Missstand. Warum müssen die Reiter, nicht wie alle Hundehalter, die Scheiße ihrer Viecher aufsammeln? Gelten für die Reiter mit ihren Pferden andere Gesetze? Klar, müssten die Säcke etwas grösser sein, vermutlich bräuchte man eine Schaufel, um solche Haufen in einen Sack zu bekommen, aber machbar wäre dies auf jeden Fall. Zudem wären diese Haufen, im Gegensatz zu Hundescheiße, als Dünger sehr gefragt. Vermutlich hat sich aber die wohlhabende Lobby der Reiter erfolgreich gegen ein mühsames Absteigen vom Pferd für das Säubern des Feldweges gewehrt.
Ist das nicht eine himmelschreiende Sauerei?
Äh, wenn ich mir das so überlege... äh, dann glaube ich doch nicht.
Mist!
©Krumm, Daniel
Mai 2018
PENDEL
Der Begriff ‚Pendel’ kennt weit mehr als nur eine Definition. Da gibt es die Uhr, dessen Pendel den Takt vorgibt, um das Uhrwerk präzise anzutreiben, oder der esoterische Pendel, der anzeigt, wo ein Kraftfeld Muskeln zeigt. Oder der mächtige Foucaultsche Pendel, der uns die Erdrotation veranschaulicht, wie auch die Abrissbirne, die Altbauten schwungvoll in seine Bestandteile zerlegt. Allerlei Physik, die unser Leben beeinflusst, auf welche Weise auch immer.
Und dann gibt es da noch das Pendeln, der physische Vorgang, unteranderem aber auch die regelmäßige Hin- und Rückfahrt zum und vom Arbeitsplatz. Einverstanden, das Pendeln zwischen der Wohnung und dem Arbeitsplatz entspricht nicht der frei schwingenden Bewegung eines Gewichts an einer Schnur oder an einem Stab, trotzdem findet beim Pendeln eine höchst gleichmäßige und sich wiederholende Bewegung statt. Hin und her, her und hin, jeden Tag, während jeder Arbeitswoche, immer zur selben Zeit und auf dem gleichen Weg.
Seit bald einem Jahr tue ich mir das freiwillig an. Nicht aus einer Not heraus, nicht aus Zwang oder weil mir wegen flegelhaftem Rasen in angetrunkenem Zustand der Führerschein abgenommen wurde. Nein, ich pendle aus Vernunft. Die Begründung meines Pendelns löst ganz verschiedene Reaktionen aus. Unverständnis, Zweifel an meinem geistigen Zustand, Verdacht auf eine idealistische Verwirrung, Vermutungen zu finanziellen Problemen oder schlichtweg einen Hinweis auf erste Alterserscheinungen.
Vielleicht sollte ich präzisieren. Zu Beginn war es die Vernunft, aber schnell wurde es zu einem Selbstversuch, mit dem Ziel, herauszufinden, was der Mensch ertragen kann. Eine Erfahrung fürs Leben, die jeder Erwerbstätige machen sollte, wie ein Mann kein Mann ist, wenn er nie in der Armee war. Ein Stahlbad für Toleranz und Sinne.
Einen Eindruck gefällig?
Da gibt es den frühmorgendlichen Härtetest, eine heimtückische Art des Erwachens. Kaum in der Straßenbahn, drängen sich einem bereits erste Gerüche auf, eine bunte Mischung aus kaltem Schweiß und ungewaschenen Kunstfaserkleidern, angereichert mit der Süße eines Energiegetränks aus der Dose. Dem auszuweichen wird schwierig, denn die Sitzordnung ist gegeben, und weiter vorne hängt jener junge Mann schlaff im Sitz, welcher trotz Ohrstöpseln seine Umgebung mit nervigen Elektrobeats beschallt. Es gilt dreizehn Minuten auszuhalten.
Am Bahnhof öffnet sich die Tür, und die Leute draußen wollen einsteigen bevor die Leute drinnen aussteigen können. Es entsteht ein fürchterliches Gewürge. Ich presse mich in den Pulk, werde von diesem Organismus einverleibt, verdaut und nach zwei Meter ausgeschissen. Ich taumle Richtung Haupteingang und versuche nicht von irren Elektrofahrradfahrern abgeschossen oder von einer Tram überrollt zu werden. Wie ich die Bahnhofshalle betrete, bricht der tägliche Tsunami über mich herein. Soeben haben sich zwei Züge entleert und gefühlte tausend schlecht gelaunte Pendler eilen mir entgegen. Wie glühende Magma walzt eine Menschenmasse auf mich zu, furchterregend, bedrohlich, unbarmherzig, lückenlos. Einzig am Rand kann ich durchschlüpfen, erreiche die Rolltreppe, auf der sich rempelnd die Eiligen an mir vorbei drängeln. Oben angekommen, möchte ich die Seite wechseln, denn da drüben gibt es das beste Croissant für mein Frühstück vor dem Bildschirm. Kleinste Freiräume nutzend, mit katzengleicher Geschmeidigkeit und manchmal auch mit resoluter Sturheit schlängle ich mich durch den Strom aus Arbeitern, der sich langsam zu lichten beginnt. Wieso muss ich in diesem Augenblick immer an Ameisen denken?
Dafür werde ich von der Verkäuferin mit einem warmen Lächeln belohnt, während sie mir das bereits eingetütete Croissant entgegenstreckt. Ich zahle, lächle zurück, und wir verabschieden uns mit netten Worten. Diese zwanzig Sekunden waren soeben der Höhenpunkt auf dem Weg zur Arbeit. Wie ich mich umdrehe, ist die Menschenwalze verschwunden, wie eine Welle die am Strand versickert ist. Weiter zu Gleis 9, hinein in die S1, dann folgt die Sitzplatzsuche. Wie in der Straßenbahn herrscht auch in der S-Bahn eine gewisse Ordnung, die nur von jenen Menschen unterwandert wird, welche nicht regelmäßig diesen Zug benützen. Solch orientierungslose Seelen gibt es immer wieder, also braucht es eine hervorragende Menschkenntnis, um sich nicht fatalerweise auf den falschen Platz zu setzen.
An diesem Morgen finde ich am Ende des Zugs ein ganzes Abteil für mich allein, wo ich mich vom Glück beseelt niederlasse und ein Buch hervorhole, damit ich während den kommenden fünfundzwanzig Minuten etwas Entspannung finden kann. Vergiss es! Kurz vor Abfahrt gesellt sich eine Gruppe von vier portugiesischen Bauarbeitern in meine Nähe. Ich hatte bis anhin keine Ahnung, dass Portugiesen so viel und so laut palavern können. Ohne Punkt und Komma werden ganze Wortkaskaden losgelassen, und dies meist gleichzeitig. Sie scheinen es lustig zu haben. Laute Fröhlichkeit am Morgen finde ich ätzend. Was würde ich geben, wenn sie, wie alle normalen Pendler, dumpf in ihre Smartphones starren und dabei zärtlich das Display streicheln würden. Lesen kann man vergessen. Was bleibt? Den Platz zu wechseln, wäre eine Option, allerdings irre ich nicht gerne mit suchendem Blick durch den Gang, um schlussendlich als Bittsteller zu warten, bis jemand mürrisch seinen ausgebreiteten Besitz und die ausgestreckten Beine zur Seite geräumt hat.
Und da gibt es noch die visuellen Herausforderungen. Heute sitzt solch eine schräg gegenüber und offenbart mir ihre leibliche Fülle. Kann man diesen pubertären Mädchen nicht schonungsvoll beibringen, dass ein bauchfreies Top nur getragen werden kann, wenn man schlank ist? Wenigstens telefoniert sie heute nicht laut schluchzend mit ihrem Freund, der sehr gemein zu ihr sein kann. Schwein gehabt.
Ich ergebe mich einmal mehr dem pendlerischen Schicksal, tröste mich mit den Bildern aus Japan, wo uniformierte Bahnangestellte mit weißen Handschuhen die Fahrgäste wie Schafe in die Bahnwagen drücken, damit die Türen geschlossen werden können. Da herrschen bei uns direkt paradiesische Zustände.
Entgegen allem Trost – Pendeln ist ein erbarmungsloser Angriff auf die Sinne. Töne, Gerüche und Bilder, die man gar nicht wahrnehmen möchte, werden einem ungefragt aufgezwungen. Nicht genug, man wird getrieben wie ein Schaf. Man fühlt sich als Herdentier. Manchmal denke ich mir, dass man den Mindeststandard fürs Pendeln den heutigen Tierschutzbestimmungen anpassen sollte.
Ich werde nach siebzig Minuten in meinem Büro angekommen sein, wie immer, werde ich es überlebt haben, allerdings fürchte ich mich bereits vor dem Heimweg. Der ist viel schlimmer.
©Krumm, Daniel
Mai 2018
MITTELMASS
Nicht zu wissen, was Mediokrität bedeutet, könnte dazu führen, von wissenden Leuten im öden Mittelmaß der Bildung angesiedelt zu werden. Selbstverständlich wird man nicht einzig an dieser speziellen Unkenntnis gemessen, aber sinnbildlich steht sie für einen eingeschränkten Wortschatz. Wie will man das Leben meistern, wenn man nicht einmal den gehobenen Ausdruck für Mittelmaß kennt? Das sind schlechte Aussichten auf Erfolg. Man ist nur Mittelmaß.
Mittelmaß, Durchschnitt, Mittelschicht, Mittleres Kader, Politische Mitte, Mittelwert, Goldene Mitte, Standard, alles im grünen Bereich, aber nicht berauschend. Weder gut noch schlecht, nur knapp über der Norm.
Wenn der Chef beim Jahresgespräch meint: „Ihr Leistung ist okay, aber…“, dann wissen sie Bescheid über ihre Mittelmäßigkeit. Jedes weitere Wort ist unnötig. Schlimmer ist nur, wenn er vor dem ‚okay‘ kurz zögert, dann will er ihnen zu verstehen geben, dass sie nur ganz knapp an der Unterdurchschnittlichkeit vorbei schrammen. ‚Okay‘ ist wie ‚nett‘. Liebe Männer, bezeichnet nie eine Frau als nett! Dies wäre der Kardinalsfehler bei der Pflege einer zukunftsorientierten Beziehung. Verständlich, wer will schon Durchschnitt sein, wenn es um das Aussehen und den Charakter geht.
Sich selbst sieht man ja gerne aus dem Mittelmaß herausragen, was leider von den Meisten vollkommen anders wahrgenommen wird. Irgendjemand unterliegt da einer kolossalen Fehleinschätzung. So stellt sich die Frage, welches Maß für die Bewertung der Durchschnittlichkeit genommen werden kann. Die gängigen Bemessungsgrundlagen, wie Erfolg, Reichtum, Schönheit und Macht, reduzieren den Anteil an überdurchschnittlichen Menschen auf mickrige zehn Prozent der Bevölkerung, also braucht es dringend neue Maßstäbe, wenn Menschen wie ich, in ihrer wahren Größe erkannt werden wollen.
Aber vielleicht liegt es gar nicht am Maßstab, sondern an den fehlenden Gelegenheiten, um sich beweisen zu können. Einverstanden, meine Überlegung scheint unausgegoren, da schließlich die mediale Welt genügend Wege zur Unsterblichkeit anbietet. Reality-TV und Social-Media drängen sich geradezu auf, wenn es um sympathische Selbstdarstellung, öffentliche Persönlichkeitsentwicklung, Zurschaustellung wahrer Fähigkeiten oder ähnlichen Peinlichkeiten geht. Ihr spürt leichten Zynismus zwischen meinen Worten? Möglich. Zudem funktioniert es nicht. Entweder macht man sich zum Gespött oder der kometenhafte Aufstieg in die Sphäre der Überdurchschnittlichkeit flacht ab und in der Regel folgt der freie Fall in die Finsternis der Unterdurchschnittlichkeit. Jeder weiß das, und kaum jemand lässt sich davon abhalten. Ein Lottogewinn wäre noch eine Option, aber mit seinen einunddreissigkommafünf Millionen möglichen Zahlenkombinationen hat das weniger mit überdurchschnittlichem Können, dafür mehr mit unwahrscheinlichem Glück zu tun. Kein ruhmreicher Aufstieg, ähnlich der Heirat in eine reiche Familie.
So bleibt wohl nur der harte und steinige Weg. Viel Fleiß und Schweiß oder eine außerordentliche Begabung. Am besten alles zusammen.
Das ist mir zu anstrengend, da bleibe ich mal lieber Durchschnitt…
©Krumm, Daniel
Mai 2018